1882 (183 Briefe)
185. An Heinrich Köselitz in Venedig
Hier, lieber Freund, kommt Carmen: aber zur Strafe für Ihre Moralpredigt über „Glücksgüter“ soll sie Ihnen nur bis zu unserm nächsten Wiedersehen angehören! — Der Klavierauszug, den ich gestern durchlas, ist französisch-mager, es fehlt alle Zukost! Doch sind die Gesangspartien vollständig — und Sie errathen doch alles! Ich habe mir erlaubt, einige Randglossen hineinzuschreiben — im Vertrauen auf Ihre Humanität und Musikalität. In summa gebe ich Ihnen vielleicht eine schöne Gelegenheit, über mich zu lachen — Carmen gehörte wirklich in diesem Winter zu meinen „Glücksgütern“, und Genua ist mir um dieser Oper willen sehr viel werther geworden. — Ihr Brief hatte eine himmlische venetianische Farbe, ich bin glücklich über das Versprechen, sich mit Venezia nicht nur in heimlicher Ehe zu vermählen.
F.N.
186. An Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Meine liebe Schwester, Deine Verse sind vom allerbesten Takte eingegeben — Takt nach fünf Seiten hin: und für alle Dinge mit 5 Seiten hat Dein Brüderchen so gute Äugelchen. Im ersten Gedicht würde ich vorschlagen zu ändern: „denn da soll Jeder fragen“, und im zweiten sind richtige Hexameter überall herzustellen
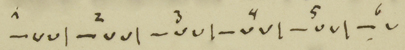
Statt der 2 Kürzen kann auch eine Länge stehn, außer im 5ten Fuße. — Wegen des 2ten Februars bin ich ganz einverstanden. —
Schmeitzner hat wahrsch<einlich> keine Einbanddecken mehr, sondern alles nach Bayreuth abgeliefert: und nach B<ayreuth> möchte ich nicht gerne schreiben — ich habe es abgelehnt, diese Blätter noch zu lesen, und man weiß das dort. Meinen Jahresbeitrag von 20 Mark zahle ich fort — scheint Dir dies schicklich? — Wie viel Jahrgänge sind es? Dir und unsrer lieben Mutter den schönsten Dank für die guten Weihnachtsbriefe und Neujahrswünsche. Ich bin wieder krank gewesen.
187. An Heinrich Köselitz in Venedig
Welche Freude machte mir Ihr Brief! Wie haben Sie mich über mich selber beruhigt! — So ein einsames Wesen ist allen Gefahren der Geschmacks-Verirrung preisgegeben; nun, wenn ich jetzt mich verirrt habe, so doch mit Ihnen zusammen! —
Ich hätte Ihnen jeden Tag schreiben mögen, aber Arbeitsamkeit oder Krankheit (abwechselnd) disponiren über meine Augen-Kräfte. Werde ich es aushalten?
Das Wetter ist so, daß ich jeden Tag mit der Frage beginne und schließe: „gab es je so gutes Wetter?“ — wie gemacht für meine Natur, frisch, rein, mild.
Das neue Jahr brachte ein „Huldigungsschreiben“ aus Amerika, im Namen von 3 Personen (darunter ein Professor des Peabody-Instituts in Baltimore) — Ich bin Ihnen so nahe, Stunde für Stunde!
F.N.
188. An Ida Overbeck in Basel
Meine liebe und verehrte Frau Professor, wenn ich zu Ihrem Briefe, mit dem Sie meinem Neujahre einen festlichen Glanz gaben, den letzt angelangten amerikanischen Brief hinzunehme, so muß ich sagen: ich verdanke zweien Frauen den beredtesten Ausdruck dafür, daß meine Gedanken wirklich auch gedacht und bedacht werden und nicht nur gelesen (oder richtiger: „und nicht nur nicht gelesen!“) Jener Brief kam von der Gattin eines Professors des Peabody-Instituts in Baltimore; welche im Namen ihres Mannes und eines Freundes mir dankt, wie Sie mir danken, auf eine denkende Art! Nun, das sind die Ausnahmen, und ich genieße sie ganz als Ausnahmen; die Regel war bisher: keine Wirkung oder eine gedankenlose Wirkung! Sie werden mir es glauben, daß ich deshalb nicht von den Menschen gering denke und daß von allen Mienen mir die Miene des „verkannten Genies“ die lächerlichste dünkt. Eine sehr langsame und lange Bahn wird das Loos meiner Gedanken sein — ja ich glaube, um mich etwas blasphemisch auszudrücken, an mein Leben erst nach dem Tode und an meinen Tod während des Lebens. Und so ist es billig und natürlich! —
Wenn ich Sie wiedersehe, werde ich Ihnen einige curiose Einzelheiten erzählen — heute nur ein Wort über die Möglichkeiten dieses „Wenn-ich-Sie wiedersehe“. Ich bin in Genua durch eine Arbeit gebunden, die hier, nur hier zu Ende kommen kann, weil sie einen Genueser Charakter an sich hat — nun, warum soll ich es Ihnen nicht sagen? Es ist meine „Morgenröthe“, angelegt auf 10 Capitel und nicht nur auf 5; und sehr Vieles, was in der ersten Hälfte steht, ist nur der Unterbau und die Vorbereitung von etwas Schwererem, Höherem (ja! es wird auch manches „Schauderhafte“ noch gesagt werden müssen, liebe Frau Professor!) Kurz, ich weiß nicht, ob ich im Sommer nordwärts fliegen kann: reise ich aber, so komme ich über Basel und zu Ihnen ins Haus.
In Bayreuth werde ich dies Mal durch meine Abwesenheit „glänzen“ — es sei denn, daß Wagner mich noch persönlich einlüde (was nach meinen Begriffen von „höherer Schicklichkeit“ sich recht wohl schicken würde!) Mein Anrecht auf einen Platz will ich ganz schlafen lassen. Im Vertrauen gesagt: ich würde „Scherz List und Rache“ lieber hören als den Parsifal.
Damit Sie wissen, was zwischen Herrn Köselitz und mir vorgeht, und wie ich fortfahre „die Jugend zu verderben“ (— der Schierlingsbecher wird mir wohl nicht entgehen!) so lege ich den letzten Brief des Herrn Köselitz bei: er wird Ihnen vielleicht einige „Verwunderung“ machen, aber ganz gewiß keinen „Schauder“!
Das Wetter der letzten Monate war der Art, daß ich nichts Schöneres und Wohlthätigeres aus meinem ganzen Leben dagegen zu setzen hätte — frisch, rein, mild: wie viele Stunden habe ich am Meere gelegen! Wie viele Male sah ich die Sonne untergehen!
Liebe Frau Professor, „alles Gute ist unter Freunden gemeinsam“ — sagen die Griechen: möge uns*! das Leben noch viele Gemeinsamkeiten schenken! — das dachte ich als ich Ihren Brief las.
Von Herzen Ihnen dankbar und ergeben
Dr. F. Nietzsche.
189. An Heinrich Köselitz in Venedig
Lieber Freund, ich habe mir eben einen Brief an Hofkapellm<eister> Levy in München ausgedacht, der mir ehedem bekannt war — zuletzt muß ich mir aber doch erst Ihre Erlaubniß zu diesem Schritt erbitten. Vielleicht könnte ich selbst einen Brief an den König bewerkstelligen (mit Benutzung der „Gelegenheit“, daß ich ihm meine „Morgenröthe“ überschickte!) Ich bin seit Ihrem Briefe zu Allem bereit und zu mehr noch. Soll ich an Bülow schreiben? Geben Sie mir schnell einen Wink, so geschieht’s. Würde Ihre Reise nach dem Norden ein Abbrechen Ihrer Venediger Existenz bedeuten? Und wann würden Sie reisen? —
Ich habe auf Gersdorff’s Karte sofort geantwortet (Leipzig Lindenstr. 10) und erwartete, nach der Art dieses Briefes, daß G<ersdorff> unmittelbar schreiben würde. Aber ein Monat ist fort ohne einen Brief. Was ist geschehen? —
Ich schrieb vorgestern an Frau Overbeck, daß ich „Scherz, List und Rache“ viel lieber hören möchte als den Parsifal. Aber ein „Philosoph“ ist seinen Freunden so unnütz! —
190. An Heinrich Köselitz in Venedig
Nun, mein lieber Freund, ich schreibe Ihnen ein paar Zeilchen — am liebsten wäre ich jetzt bei Ihnen. Wirklich, Sie waren in der Gefahr, von mir überrascht zu werden — nichts als die Meldung meiner Angehörigen, daß der längst angekündigte Besuch des Dr. Rée nahe bevorstehe, hat mich hier in Genua zurückgehalten. Was Sie jetzt erleben, das ist die Regel — ich war im vorigen Sommer so erstaunt, so außer mir vor Erstaunen, daß die Dinge in Bezug auf Sie und Ihre Schätzung einmal anders und ausnahmsweise gehen sollten. Aber ich möchte gern Ihnen ein wenig über diese verfluchte „Regelmäßigkeit“ hinweghelfen oder — um die Wahrheit zu sagen — mir von Ihnen darüber hinweghelfen lassen; denn ich bin über dieser Wienerischen Zurückweisung nicht nur böse, sondern beleidigt, ja förmlich krank und aller guten Dinge unfähig geworden. Es klang mir wie ein höhnischer Protest gegen meine eben zu Papier gebrachte friedliche Denkweise und „Gott-Ergebenheit“. Das beste Gegenmittel wäre nun: miteinander etwas zu lachen und gute Musik zu machen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr es mich nach Ihrem matr<imonio> segr<eto> gelüstet. An dem Tage, an dessen Abende Ihr Brief anlangte, hatte ich mir überlegt, daß alle nähere Disposition über meine Aufenthalte und alle Eintheilung dieses und des nächsten Jahres von der Musik des Hrn. Peter Gast und vom Schicksale dieser Musik abhänge, — ich erwog einen Winter in Wien und Venedig. Wahrlich, lieber Freund, es giebt so erstaunlich wenig des Guten, das von außen her zu mir käme, ich bin in meiner Einsamkeit wie eingeschneit und lebe so hin, ein wenig allzu verlassen und allzu todt geschätzt, selbst von meinen Freunden. Nur Sie und Ihre Zukunft — Nausikaa eingerechnet —, nur Ihre Briefe und Gedanken sind die schöne Ausnahme in meinem „Winter“, und wahrscheinlich das, was mir am meisten Wärme bringt und erhält.
Ein paar Worte über meine „Litteratur“. Ich bin seit einigen Tagen mit Buch VI, VII und VIII der „Morgenröthe“ fertig, und damit ist meine Arbeit für diesmal gethan. Denn Buch 9 und 10 will ich mir für den nächsten Winter vorbehalten — ich bin noch nicht reif genug für die elementaren Gedanken, die ich in diesen Schluß-Büchern darstellen will. Ein Gedanke ist darunter, der in der That „Jahrtausende“ braucht, um etwas zu werden. Woher nehme ich den Muth, ihn auszusprechen!
Heute las ich, zum ersten Male seit letztem Sommer, etwas in meiner „Morgenröthe“ und hatte Vergnügen dabei. In Anbetracht daß diese Dinge sehr abstrakt sind, ist die Munterkeit des Geistes, mit der sie behandelt sind, ganz achtbar. Lesen Sie zur Vergleichung irgend ein Buch über Moral — ich habe immer noch meine Sprünge und Hopsasa’s für mich. Daneben zog mich an, wie reich das Buch an unausgesprochnen Gedanken ist, wenigstens für mich: ich sehe hier und dort und an allen Enden verborgene Thüren, die weiter und oft sehr weit führen (und nicht nur auf „Abtritte“ — Pardon!)
Wollen Sie mein neues Manuscript? Vielleicht macht es Ihnen eine Unterhaltung und Zerstreuung. (Denken Sie ja nicht an’s Abschreiben — das hat noch ein Jahr Zeit und vielleicht sogar sehr viel mehr)
Es fällt mir ein, daß ich das M<anu>s<cript> aber selber noch einmal durchlesen muß, damit Sie es lesen können (Es fehlen viele Zeichen und auch einige Worte) In Anbetracht, daß Gesundheit und Augen mich in Stich lassen, dürfte ich vor 2 Wochen mit dieser Correktur und Durchsicht nicht fertig werden.
Der Januar ist der schönste meines Lebens. Aber er hatte nur 21 Tage! —
Von Herzen Ihr Freund F N.
191. An Heinrich Köselitz in Venedig
Lieber Freund, Hr. v. Bülow hat die Unarten preußischer Offiziere an sich, ist aber ein „ehrlicher Kerl“ — daß er sich mit deutscher Opernmusik nicht mehr befassen will, hat geheime Gründe aller Art; mir fällt ein, daß er mir einmal sagte „ich kenne Wagner’s neuere Musik nicht“. — Gehen Sie im Sommer nach Bayreuth, da finden Sie alle Theater-Menschen Deutschlands bei einander, und auch Fürst Liechtenstein u.s.w., Levy ebenfalls. Ich denke, daß alle meine Freunde dort sein werden, auch meine Schwester, nach ihrem gestrigen Briefe (und das ist mir sehr lieb!).
Wäre ich bei Ihnen, so würde ich Sie mit Horazens Satyren und Episteln bekannt machen — ich meine, dafür sind wir Beide gerade reif. Als ich heute hineinguckte, fand ich alle Wendungen bezaubernd, wie einen warmen Wintertag.
Mein letzter Brief war Ihnen zu „frivol“, nicht wahr? Haben Sie Geduld! In Bezug auf meine „Gedanken“ ist es mir nichts, sie zu haben; aber sie loswerden, wenn ich sie lossein will, wird mir immer verteufelt schwer! —
Oh welche Zeit! Oh diese Wunder des schönen Januarius! Seien wir guter Dinge, liebster Freund!
192. An Franz Overbeck in Basel
Mein lieber Freund, gestern schrieb mir meine Schwester, daß sie gerne von meinem „Anrecht“ auf einen Platz in Bayreuth Gebrauch machen würde: nun, wenn es nicht zu spät ist, wohlan, so will ich das Formular, von dem Du mir schriebst, unterzeichnen — denn von den Quittungen habe ich nichts mehr. — Übrigens ist es mir lieb, von diesem Entschlüsse meiner Schwester zu hören; ich denke, daß alle meine Freunde dort sein werden, auch Herr Köselitz. Ich selber aber habe Wagner’s zu nahe gestanden, als daß ich ohne eine Art von „Wiederherstellung“ (κατάστασις πάντων ist der kirchliche Ausdruck), als einfacher Festgast dort erscheinen könnte. Zu dieser Wiederherstellung, die natürlich von Wagner selber ausgehen müßte, ist aber keine Aussicht; und ich wünsche sie nicht einmal. Unsere Lebens-Aufgaben sind verschieden; ein persönliches Verhältniß bei dieser Verschiedenheit wäre nur möglich und angenehm, wenn Wagner ein viel delikaterer Mensch wäre. Ich denke, lieber Freund, Du verstehst mich hierin. Jene nun einmal eingetretene Entfremdung hat ihre Vortheile, die ich nicht so leicht, gegen einen Kunstgenuß, oder aus reiner „Gutmüthigkeit“, wieder aufgeben werde. Freilich: ich verliere die einzige Gelegenheit, einmal alle, die mir nahe stehen oder standen, wieder zu sehen, und viele wacklig gewordene Verhältnisse wieder fest zu machen. Da ist Freund Rohde, der mir seit der Übersendung der „Morgenröthe“ kein Wort gegönnt hat, ganz wie Fräulein von Meysenbug und so weiter. Nun, wenn Du mit Deiner lieben Frau dort bist, so bitte ich, für mich bei dem und Jenem ein freundliches Wort einzulegen. Ich bin wahrlich kein „Unmensch“ geworden! —
Gestern sandte ich das neue Manuscript an Hrn. Köselitz nach Venedig ab. Es fehlen noch das 9te und 10te Buch, welche ich jetzt nicht mehr machen kann — es gehört frische Kraft dazu und tiefste Einsamkeit (Dr. Rée kommt in nächster Woche) Vielleicht finde ich einen Monat in diesem Sommer, der mir beides giebt, in irgend einem Walde: ich habe an die Wälder Corsica’s gedacht, aber auch an den Schwarzwald (St. Blasien?) Vielleicht aber muß ich mit dieser schwersten aller meiner Aufgaben bis zum Winter warten.
Inzwischen giebt es böse Neuigkeiten von Hrn. Köselitz. Die Wiener haben die Partitur ihm zurückgeschickt; ein Versuch, den er darauf anstellte, Bülow’s Interesse für sein Werk zu gewinnen, mißlang ebenfalls (er will nichts mehr mit deutscher Opermusik zu thun haben). — Ich bin für Alles unsäglich dankbar, was unserem armen Freunde in dieser schweren Lage wie eine Ermunterung und Genugthuung klingen könnte. — Übrigens ist er Philosoph, mehr als ich. Wahrhaftig, ich selber trage härter an seinem Mißerfolg als er! —
Mein lieber Freund, was mache ich Dir doch immer für Mühe und Noth! — Wenn wir uns wiedersehn, so erweisest Du mir die Ehre mir Deinen Vortrag über die Entstehung der christl. Litteratur vorzulesen? — Habt Ihr auch einen solchen „Frühling“ wie wir? Die wahren „Wunder des heiligen Januarius!“ —
Von Herzen Dein und Euer
Friedrich Nietzsche
193. An Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Ja, wie soll ich Dir nur gleich antworten, meine geliebte Schwester? Ich bin nämlich mit Deiner Schreibmaschinen-Schenkung noch nicht bei mir im Reinen; wenn ich Dich wiedersehe, werde ich Einiges zu sagen haben, was ich nicht zu schreiben wüßte. —
In Betreff des Bayreuther Platzes, der Dir natürlich ganz zu Gebote steht, habe ich sofort an Overbeck geschrieben. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Es ist mir sehr lieb, daß Du dort sein willst; Du wirst alle meine Freunde dort finden. Ich aber — Verzeihung! — komme gewiß nicht hin, es sei denn, daß W<agner> mich persönlich einladet und als den geehrtesten seiner Festgäste behandelt. (Ich muß nachgerade die „Etiquette“ für mich etwas feststellen). — Gestern sandte ich das neue M<anu>s<cript> an Hrn. Köselitz (Fortsetzung der „Morgenröthe“) Aber gedruckt wird dies Jahr nicht! —
Von Herzen dankbar
F.
194. An Franziska Nietzsche in Naumburg
Meine liebe Mutter, so laufen die Jahre dahin, eines immer schneller als das andre. Man lernt eben das Spiel des Lebens endlich auswendig — man bekommt es, wie die Klavierspieler sagen, zuletzt „in die Finger“; deshalb geht es so geschwinde! Das merke ich schon: um wie viel mehr wirst Du es merken! Und ebenso wenig wie mir, wird Dir an Deinem Geburtstage mit Wünschen gedient sein; festhalten, was man hat, ist das Haupt-Kunststück des späteren Lebens, und wissen, was man voraus hat vor so Vielen, und namentlich vor allen Unzufriednen! Das Jahr macht Dir ein heiteres Gesicht: sehen wir zu, daß auch wir Dir Grund zur Heiterkeit und zum Wohlgefühle des Lebens geben! Gleich diesem schönsten aller Januare! —
Hier ist es immer wie im Frühling: man kann schon des Vormittags im Freien sitzen, und zwar im Schatten — ohne zu frieren. Kein Wind, keine Wolke, kein Regen! Ein Greis sagte mir, es habe noch nie einen solchen Winter in Genua gegeben. Das Meer still und tief gesunken. Die Pfirsiche blühen! — Giebt es freilich einen Nach-Winter, so ist es mit den Oelbäumen und dem ganzen Obste schlimmer als je! — Ich sehe die Soldaten im leichtesten Leinen-Anzuge; ich selber habe auf meinen Spaziergängen dieselben Kleider an, wie im Engadiner Sommer, mit dessen guten Tagen das jetzige Wetter verwandt ist. Aber freilich: das mir schädliche Wetter war bei meinem letzten Aufenthalte da oben so überwiegend, und das Ganze in summa eine solche Geduldsprobe, daß ich dieses Jahr mir das Engadin verbiete. —
Trotz diesem Wetter ist mein Befinden sehr variabel gewesen; und es hätte mir viel besser gehen müssen, wenn ich nicht auch in diesem Winter etwas zu arbeiten gehabt hätte. Und eine regelmäßige geistige Arbeit Tag für Tag zu bestimmten Stunden ist immer noch das sicherste Mittel, mich unvermerkt zu Grunde zu richten. „Unvermerkt“ — das heißt, es kommt ein Tag, wo ich merke, daß es sehr schlimm steht, und wo die Erholung nicht mehr in einigen Ruhetagen geschafft werden kann. - - - Zu alledem bin ich seit October vielen Zahnschmerzen unterworfen gewesen — es giebt etwa 6 hohle Zähne, und das Wort „Zahnoperationen“ hat mich mit Neid erfüllt. Vielleicht muß ich mich schließlich doch entschließen, nach Florenz zu Dr. van Marter zu reisen, der mich schon einmal unter den Händen gehabt hat. — Neuerdings bin ich mit einem anderen Leiden bekannt geworden, das seine eigene Unannehmlichkeit hat; mich quält jetzt ein Blasen-Leiden und will nicht vor mir weichen. Kurz, Du siehst, es ist noch manches von mir auszuhalten, und ich habe guten Muth nöthig, der sich nicht so leicht auf dem nächsten Markte kaufen läßt.
So! Mehr darf ich für diesen Tag nicht schreiben, die Augen schmerzen schon. — — Ich erwarte mit großem Verlangen die Ankunft des Dr. Rée — er wird gerade in dem Carneval hineinkommen, der diesmal den Besuch der berühmten Französin Sarah Bernhardt bietet. Wir werden 3 Tage (am 5ten, 6ten und 7ten Februar) französisches Schauspiel haben, in unserm großen Carlo-Felice-Theater, welches 3000 Menschen faßt — und es wird voll sein. —
Nochmals, meine liebe gute Mutter, ich will zusehen, daß Du in diesem Deinem neuen Jahre durch mich keine neue Noth hast — bei der alten wird es wohl verbleiben! —
Von Herzen Dein Sohn
Friedrich.
Nicht wahr, ich erfahre genau die Stunde der Ankunft meines Freundes, daß ich am Bahnhof sein kann? Will er einen Monat hier bleiben und soll ich darauf hin miethen? — Salita delle Battistine 8, interno 6 ist die Adresse.
195. An Heinrich Köselitz in Venedig
Mein lieber Freund, ich finde Ihre Behandlung des Bülow’schen Falles ganz angemessen — ich glaube, Bülow selber wird sie angemessen finden; er ist liberaler Impulse fähig. — Gestern kam Dr. Rée an; er wohnt im Nachbarhause und bleibt einen Monat. Heute Abend werden wir Beide zusammen im Theater Carlo Felice sitzen, um Sarah Bernhardt zu bewundern, als la dame aux camelia’s (Dumas fils). Die Schreibmaschine (eine Sache von 500 frs.) ist hier, aber — mit einem Reise-Schaden: vielleicht muß sie wieder zur Reparatur nach Kopenhagen, heute werde ich von dem ersten hiesigen Mechaniker darüber Bescheid erhalten. —
Gersdorff glaubt, daß eine Aufführung von Scherz L<ist> und Rache in Leipzig zu ermöglichen ist — erzählt Rée. — Nerina hat die Verlobung G<ersdorffs>’s ziemlich tragisch genommen und macht dem Armen Noth. —
Wie? Sie gehen zuletzt nicht nach Bayreuth? — Ich empfinde bei dieser Möglichkeit zu verschieden auf Ein Mal, um sagen zu können, wie es mich berührt. Aber es scheint mir nicht nützlich — und sei es auch nur, daß Sie Wagner’s Orchester und seine Orchester-Erfindungen kennen lernen müßten. Zuletzt: ich wüßte Sie sehr gerne einmal unter allen meinen Freunden, die, wie ich mir vorstelle, an Ihnen versuchen werden gut zu machen, was sie in Bezug auf mich auf dem „lieben Herzen“ haben — Pardon, daß ich davon rede!
„Causalitäts-Sinn“ — ja, Freund, das ist etwas Anderes als jener „Begriff a priori“ von dem ich rede (oder fasele!) Woher kommt der unbedingte Glaube an die Allgültigkeit und All-Anwendbarkeit jenes Causalitäts-Sinnes? Leute wie Spencer meinen, es sei eine Erweiterung auf Grund zahlloser durch viele Geschlechter gemachter Erfahrungen, eine zuletzt absolut auftretende Induktion. Ich meine, dieser Glaube sei ein Rest eines älteren viel engeren Glaubens. Doch wozu dies! Ich darf über so etwas nicht schreiben, mein lieber Freund, und muß Sie auf das „9te Buch“ der M<orgenröthe> verweisen, damit Sie sehen, daß ich am wenigsten von den Gedanken abweiche, welche Ihr Brief mir darlegt: — ich freute mich dieser Gedanken und unsrer Übereinstimmung.
Das neue „Journal“ hat mich gar nicht unangenehm überrascht. Oder täusche ich mich? Ist dieser Grundgedanke seiner Einleitung — das Europäer-thum mit der Perspektive der Vernichtung der Nationalitäten — ist dies nicht mein Gedanke? Sagen Sie mir darüber die Wahrheit: vielleicht führt mich irgend welche Spiegelfechterei der Eitelkeit irre. —
Neulich gehe ich spazieren und denke an gar nichts unterwegs als an die Musik meines Freundes Gustav Krug, — rein zufällig und ohne alle Veranlassung. Den Tag darauf kommt ein Heft Lieder von ihm mir zu Händen (von Kahnt verlegt) und darunter gerade das Lied, welches ich auf meinem Spaziergang mir reconstruirt hatte. Wunderlichstes Spiel des Zufalls!
Wetter nach wie vor, unbeschreiblich! Rée und ich waren gestern an jener Stelle der Küste, wo man mir in hundert Jahren (oder 500 oder 1000, wie Sie gütigst annehmen!) ein Säulchen zu Ehren der „Morgenröthe“ aufstellen wird. Wir lagen fröhlich wie zwei Seeigel in der Sonne.
Mit den herzlichsten Grüßen Ihr getreuer Seelen-Nachbar
F.Nietzsche.
196. An Franziska und Elisabeth Nietzsche in Naumburg
Ein einziges Wörtchen heute nur, meine Lieben! Das war ja ein förmliches Weihnachten, das da über mich her fiel, und noch dazu ein rechter Weihnachtsmann dazu, obwohl keineswegs ein Brummbär! Nun wollen wir Alles versuchen, die schönen Pelzfüße und die meiner kaum erschlossenen Vogelnatur so sehr willkommenen, obwohl allzustolzen Notizbüchlein. (Eins der früheren schwarzen ist vollgeschrieben, das andere schwarze habe ich heute dem Freunde Rée verehrt —: so habe ich denn zum Gebrauche für dies Jahr die beiden Kunst- Lust- Thier- und Genie-Büchlein) Übermorgen mehr, heute nur den allerherzlichsten Gruß und Dank!
F.
197. An Franziska und Elisabeth Nietzsche in Naumburg
Hier ist zunächst der Revers für Bayreuth, welcher nun, nach Overbecks Anweisung, seinen Weiterweg an Feustel in B<ayreuth> zu machen hat, und zwar mit einer ausdrücklichen Erklärung Deinerseits, meine liebe Schwester, für welchen von den 3 Tagen der Hauptaufführung Du Dich entschieden hast (26. 28 oder 30 Juli) Dann wird er Dir die Karte senden.
Bis jetzt ist es gegangen, wie es zu erwarten stand, nicht gut. Der erste Tag sehr guter Dinge; den zweiten hielt ich mit Benutzung aller Stärkungsmittel aus; den dritten Erschöpfung, Nachmittags eine Ohnmacht; die Nacht kam der Anfall; den vierten zu Bett; den fünften stand ich wieder auf, um mich Nachmittags wieder zu legen, den sechsten und bis jetzt immer Kopfschmerz und Schwäche. Kurz, wir müssen es noch lernen, zusammenzusein. Es ist eben gar zu angenehm mit Dr. Rée zu verkehren; es giebt nicht leicht einen erquicklicheren Verkehr. Aber ich bin an das Gute nicht gewöhnt. —
Es gefällt ihm oder vielmehr: er ist ganz überrascht, wie sehr es ihm hier gefällt. —
Mit Sarah Bernhardt hatten wir Unglück. Wir waren in der ersten Aufführung; nach dem ersten Akte fiel sie wie todt nieder. Nach einer peinlichen Stunde Wartens spielte sie weiter, aber mitten im dritten Akte überfiel sie ein Blutsturz, auf der Bühne — da war es denn aus. Es war ein unerträglicher Eindruck, zumal sie eben eine Kranke der Art spielte (la dame aux camelias von Dumas fils) — Trotzdem hat sie mit ungeheurem Erfolg am nächsten und nächstnächsten Abende wieder gespielt und Genua überzeugt, daß sie „die erste lebende Künstlerin“ sei. — Sie erinnerte mich, in Aussehen und Manieren, sehr an Frau Wagner. — Mitte März geht Dr. Rée nach Rom zu Frl. v. Meysenbug. — Mit der Schreibmaschine ist noch nichts entschieden; ein äußerst geschickter Mechaniker hat jetzt eine Woche daran gearbeitet, sie herzustellen. Morgen soll sie „fertig“ sein. Hoffen wir das Beste!
Wie bin ich von Euch, meine Lieben, beschenkt worden! Und ich höre auch von Dr. R<ée> lauter Erfreuliches von Euch. Ich denke, daß unsre liebe Lisbeth jetzt oder sehr bald Gelegenheit haben wird, Frau Rée nützlich zu sein; sie reist Sonntag ab.
Mehr erlaubt die Gesundheit durchaus nicht, zu schreiben. Verzeihung!
In der größten Dankbarkeit
Euer Fr.
Welches ist Adresse und Titel Gustav Krugs?
198. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Freund Rée und ich — ja wie oft reden wir von Ihnen und sorgen und hoffen mit einander in Bezug auf Alles, was Herrn Peter Gast angeht! Wie wünschen wir Sie herbei! — denn ich habe jetzt eine Wahrscheinlichkeit mehr, daß Genua Ihnen gefallen wird: R<ée> ist ganz außer sich vor Erstaunen, wie sehr es ihm gefällt. Übrigens verspricht er Ihnen, den nächstjährigen Carneval in Venedig zu erleben, vorausgesetzt, daß Sie dabei „betheiligt“ sind — auch ich will dort sein. —
Gersdorff hat in Leipzig über Sie gesagt: „was Carlsbad ist für einen verdorbnen Magen, das ist Köselitz für einen verdorbnen Geist“.
Die Schreibmaschine ist da, aber schwer beschädigt — es wird schon eine Woche an ihr „reparirt“.
Mit unserem herzlichsten Gruße R. und N.
199. An Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Hurrah! Die Maschine ist eben in meine Wohnung eingezogen; sie arbeitet wieder vollkommen. — Ich weiß noch nicht, was die Reparatur gekostet hat. Freund R<ée> hat es mir nicht sagen wollen.
F.
200. An Franz Overbeck in Basel (Postkarte)
Mein lieber Freund, immer sich ablösende Anfälle verhinderten mich bisher, Dir für Deinen Brief zu danken und zu melden, daß ich den Bayreuther Revers nach Deiner Weisung an meine Schwester gesandt habe: die das Weitere wohl gethan haben wird. — Dr. Rée ist bei mir; er kam über Verona, sehr bedauernd, daß Basel nicht am Wege war. Es giebt nicht leicht einen gefälligeren und rücksichtsvolleren Verkehr als den seinen mit mir, und wir sind oft bis zur Ausgelassenheit heiter mit einander; er ist ganz erstaunt, wie sehr ihm Genua gefällt. — Trotzdem sehe ich wieder ein, daß absolute Einsamkeit für mich nicht eine Laune sondern die Vernunft selber ist. — Er bleibt bis Mitte März. (Ich schrieb jüngst an Frau Rothpletz, so wie früher an Deine liebe Frau: Briefe angekommen?)
Dein F.
201. An Heinrich Köselitz in Venedig (Typoskript)
Glattes Eis ein Paradeis
Fuer Den der gut zu tanzen weiss.
Willst Du nicht Aug und Sinn ermatten
Lauf auch dem Lichte nach im Schatten
Nicht zu freigebig! nur Hunde
scheissen zu jeder Stunde.
Lieber aus ganzem Holz eine Feindschaft
Als eine geleimte Freundschaft.
Nothdurft ist billig: Glueck ist ohne Preis,
Drum sitz ich statt auf Gold auf meinem Steiss.
Wie komm ich am besten den Berg hinan?
Steig nur hinauf und denk nicht dran.
Auch Rost thut noth: Scharf sein ist nicht genung:
Sonst sagt man stets von dir: „er ist zu jung“.
F.N.
202. An Heinrich Köselitz in Venedig (Typoskript)
Lieber Freund Ihr Lob meiner Reime hat mich sehr ueberrascht. Mit dergleichen unterhalte ich mich auf meinen Spaziergaengen. Sebastian Brant kenne ich nicht. Sie haben Recht — unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken. Wann werde ich es ueber meine Finger bringen, einen langen Satz zu drücken! —
Uebrigens bin ich trotz der erquicklichsten Gesellschaft immer fast wie halbtodt. Wir haben dreimal im Meere gebadet. In naechster Woche gehen wir auf zwei Tage nach Monaco. Mitte Maerz verlaesst mich der Freund um nach Rom ueberzusiedeln. Genua gefaellt ihm mehr als Sorrent und Neapel. Haben Sie vielleicht gehoert ob Wagners von Palermo zurueck sind oder ob sie Ostern in Rom erleben wollen? Ich hoerte Ihretwegen den Barbiere. Es war die musterhafteste Auffuehrung, Alles von erstem Range, wie mir schien, sogar der Kapellmeister. Aber die Musik missfiel mir. Ich liebe ein ganz anderes Sevilla. Koennen Sie mir nicht eine große Zerstreuung erfinden? Ich moechte ein paar Jahre in Abenteuern verbringen, um meinen Gedanken Zeit, Stille und frische Erdkrume zu geben. — — — — —
Ihr Freund Nietzsche.
Teufel! Können Sie das auch lesen?!
203. An Franziska und Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Typoskript)
Meine Lieben koennte ich nur auch so viel Heiteres melden wie von Euch kommt. Aber ich bin immer wie halbtodt und der letzte Anfall gehoerte zu meinen schlimmsten. In allen Zwischenpausen wie zwischen allem Elende selber lachen wir viel und reden gute und boese Dinge. Vielleicht begleite ich den Freund auf einem Ausfluge an die Riviera. Moege sie ihm so gefallen als ihm Genua gefaellt: ich bin hier doch sehr zu Hause. Eine Marquesa Doria hat bei mir anfragen lassen ob ich ihr deutschen Unterricht geben wolle: ich habe Nein gesagt. Die Schreibmaschine ist zunaechst angreifender als irgend welches Schreiben. Waehrend des großen Carnevalzuges waren wir auf dem Friedhofe dem schoensten der schoensten der Erde. Mitte Maerz geht Rée zu Frl. von Meysenbug nach Rom. Wir beide ziehen Genua der Sorrentinischen Landschaft vor. Dreimal haben wir im Meere gebadet. Mit dem herzlichsten Danke und Grusse
Euer F.
204. An Franz Overbeck in Basel (Typoskript)
Dieser Brief mein lieber Freund ist zugleich eine Fingeruebung — Verzeih und nimm fuerlieb! Mitte Maerz verlaesst mich Freund Rée um Frl. von Meysenbug in Rom zu besuchen. Ich selber bleibe nur noch bis zu Ende desselben Monats. Es wird mir schon jetzt hier zu hell. Wohin aber? — Ja, wer mir das sagen könnte! Willst Du die Guete haben mir wieder die ueblichen 500 Francs zu schicken? Koeselitzens Partitur ist jetzt in den Haenden des Baron Loën: Gersdorff hat vermittelt. Die Heirath des Letztgenannten findet am 19 Maerz statt. Er schrieb mir sehr freimuethig und tapfer und wie aus einer neuen Tonart. Romundt hat ein neues Buechlein fertig — „Christenthum und Vernunft“ —: „Haettst solln ae Pfarr waern!“ sagt Gersdorff, der die Vignette dazu gezeichnet hat. Meine Schwester war einige Zeit mit Frau Rée zusammen und ganz entzückt von ihr. Auch hoerte sie einen Vortrag des Dr. Foerster im Architecten-Hause (Berlin) der meiner zwei Mal in ausschweifenden Ausdruecken gedachte. Er will nach Suedbrasilien auswandern, es sei denn dass — —
In herzlicher Freundschaft und mit den Grüssen des Dr. Rée.
Dein F. N.
205. An Heinrich Köselitz in Venedig (Typoskript)
Lieber Freund das waeren schon Abenteuer nach meinem Geschmack: waere nur meine Gesundheit nach meinem Geschmack! Ich wuerde gern eine Colonie nach den Hochlanden Mexikos fuehren: oder mit Rée in die Palmen-Oase Biskra reisen — noch lieber kaeme mir ein Krieg. Am liebsten die Noethigung zum kleinsten Antheil an einer grossen Aufopferung. Die Gesundheit sagt zu Allem Nein. Wir waren zwei Tage in Monaco, ich wie billig ohne zu spielen. Doch waere mir den Abend in diesen Sälen zu verbringen die angenehmste Art der Geselligkeit. Die Menschen sind mir dort eben so interessant als das Gold gleichgueltig. — Wie viel gaebe ich darum ueber die Musik des Barbiers mit Ihnen gleich zu denken: Zuletzt ist auch Dies eine Sache der Gesundheit. Die Musik muss sehr passionirt oder sehr sinnlich sein, um mir zu gefallen. Beides ist diese Musik nicht: die ungeheure Gelenkigkeit ist mir sogar peinlich wie der Anblick eines Clowns. — Es ist nicht unmoeglich dass ich Ende Maerz nach Venedig komme: oder giebt es dort Stoerenfriede? Ich will Sie bitten, mir Etwas von Ihrem Muth und Ihrer Beharrlichkeit abzugeben. — Rée ehrt und liebt Sie gleich mir.
Ihr Freund N.
206. An Franziska und Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Typoskript)
Meine Lieben, mit unsrer Reise nach Monaco haben wir Glueck gehabt — ich habe nicht gespielt und Rée hat wenigstens nicht verloren. Es ist in Bezug auf Lage Natur Kunst und Menschen das Paradies der Hoelle. Das Beste war mir ein ruhiges Stuendchen in einem prachtvollen Thee-Salon, wo uns ein gepudertes und buntes Geschoepf von Diener mit ausgezeichnetem Thee versah. Diese ganze Kueste ist unglaublich theuer als ob das Geld keinen Werth habe. Mentone ist von Gersdorff fuer seine Hochzeitsreise ins Auge gefasst worden. Die Hochzeit ist am 19. Maerz. Gebt mir doch einen Rath in Betreff eines Hochzeitsgeschenkes! Wagners sind die Einzigen gewesen, die ihm nicht zu seiner Verlobung gratulirt haben. Meiner Gesundheit ist diese Jahreszeit nicht guenstig. Bei den letzten Anfaellen habe ich eine unglaubliche Menge Galle erbrochen. Diese Maschine war wieder einmal in Reparatur.
In herzlicher Liebe und sehr dankbar für Eure schoenen Briefe
Euer F.
207. An Gustav Krug in Köln (Typoskript)
Lieber Freund Mit Deinen Liedern gieng es mir seltsam. Eines schönen Nachmittags fiel mir Deine ganze Musik und Musikalität ein — und ich fragte mich schliesslich: Warum lässt er nie etwas drucken? Dabei klangen mir die Ohren von einer Zeile aus Jung Niklas. Am nächsten Morgen kam Freund Rée in Genua an und überbrachte mir Dein erstes Heft — und als ich es aufschlug fiel mir gleich Jung Niklas in die Augen. Das wäre eine Geschichte für die Herren Spiritisten! —
Deine Musik hat Tugenden die jetzt selten sind —: ich sehe mir jetzt alle neue Musik auf die immer grösser werdende Verkümmerung des melodischen Sinns an. Die Melodie, als die letzte und sublimste Kunst der Kunst, hat Gesetze der Logik, welche unsre Anarchisten als Sklaverei verschreien möchten —: gewiss ist mir nur dass sie bis zu diesen süssesten und reifsten Früchten nicht hinauflangen können. Ich empfehle allen Componisten die lieblichste aller Askesen: für eine Zeit die Harmonie als nicht erfunden zu betrachten und sich Sammlungen von reinen Melodien zum Beispiel aus Beethoven und Chopin anzulegen. — In Deiner Musik klingt mir viel gute Vergangenheit und wie Du siehst auch etwas von Zukunft. Ich danke Dir von ganzem Herzen.
Dein Freund F.N.
208. An Heinrich Köselitz in Venedig (Typoskript)
Lieber Freund — Rée hat mir Ihre Abhandlung vorgelesen und ist gleich mir wieder einmal erstaunt über Das was jetzt an einem Musiker möglich ist. Dieser derbe Thatsachensinn, diese Energie des Griffs, diese Neigung für die Gegenfüssler-Welt des Künstlers — woher kommt Ihnen das Alles? Vielleicht von Ihrem Vater her: gewiss aber nicht von Ihren Lehrern und am wenigsten von mir —: ich bin viel skeptischer und phantastischer als Sie und lerne immer mehr einsehen dass mir das Schicksal in Ihnen ein unschätzbares Erziehungsmittel geschenkt hat. Auch Ihre jetzige „Obstination“ wirkt auf mich tugendhaft zurück: ja auch ich will fertig werden, trotz meiner verfluchten Gesundheit, wie Sie fertig werden wollen trotz Loën „dem Vater der Lüge“. So nennt ihn Gersdorff der mir einen wohlgemuthen Brief geschrieben hat. Ende des Monats gehe ich „an’s Ende der Welt“: ja wenn Sie wüssten wo das wäre! Sie kämen mir am Ende nach? — Ich würde dieser Abreise wegen mein Manuscript jetzt gerne zurück haben — bitte bitte! Lieber Freund, es lebe die Freiheit, Heiterkeit und Unverantwortlichkeit! Leben wir über uns, um mit uns leben zu können!
In Treue Ihr F. N.
209. An Heinrich Köselitz in Venedig (Typoskript)
Mein lieber armer Freund, hier ein Liedchen zu unsrer Erheiterung: wir haben sie Beide so nöthig. Nun Sie gar noch anfangen, an Sich selber zu leiden, hat das Übel seinen Höhepunkt erreicht. Jetzt heisst es: sauve qui peut! Es ist unerträglich, Sie vor meinen Augen zu Grunde gehen zu sehn —: haben Sie doch darin ein Wenig Mitleiden mit mir! Zuletzt habe ich’s gerade so schlimm und thöricht getrieben wie Sie: unsre bürgerlichen Tugenden und Vorurtheile sind unsre Hauptgefahren — zum Beispiel dieser inhumane Fleiss. Wollen Sie meinen Zustand kennen lernen? Zur Strafe für die unsinnige Thätigkeit meiner ersten Basler Jahre kann ich jetzt nicht mehr die kleinste geistige Arbeit thun ohne einen Gewissensbiss —: ich empfinde jedesmal: „das ist nicht recht, du darfst nicht mehr arbeiten!“ Ihre Worte in Betreff der Augen haben mir mehr wehe gethan als irgend Etwas seit Jahren. Lassen Sie diese Partitur, jetzt und sofort! Die ganze Aufgabe Ihres Lebens tritt vor Sie hin und sagt: „So will es die Pflicht“! Die nächsten Monate müssen ganz der Genesung geweiht sein: Leib und Seele bitten und beschwören Sie darum — ich auch! Wieviel Geld brauchen Sie für drei Monate in den Bergen? Es steht Ihnen zu Gebote. Seien Sie grossmüthig gegen mich — gegen Sich! In Treue
Ihr Freund
F. N.
Lied von der kleinen Brigg genannt „Das Engelchen“.
Engelchen: so nennt man mich —
Jetzt ein Schiff, dereinst ein Mädchen
Ach noch immer sehr ein Mädchen:
Denn es dreht um Liebe sich
Stets mein feines Steuerrädchen.
Engelchen: so nennt man mich —
Bin geschmückt mit hundert Fähnchen,
Und das schönste Kapitänchen
Bläht an meinem Steuer sich:
Als das hunderterste Fähnchen.
Engelchen: so nennt man mich —
Überall hin, wo ein Flämmchen
Für mich glüht, lauf’ ich, ein Lämmchen,
Meinen Lauf sehnsüchtiglich:
Immer war ich solch ein Lämmchen:
Engelchen: so nennt man mich —
Glaubt ihr wohl, dass wie ein Hündchen
Belln ich kann und dass mein Mündchen
Dampf und Feuer wirft um sich?
Ach, des Teufels ist mein Mündchen:
Engelchen: so nennt man mich —
Sprach ein bitterböses Wörtchen
Einst, dass schnell zum letzten Örtchen
Mein geliebter Freund entwich:
Ja, er starb an diesem Wörtchen.
Engelchen: so nennt man mich —
Kaum gehört, sprang ich vom Klippchen
In den Grund und brach ein Rippchen.
Dass die Seele mir entwich:
Ja, sie wich durch dieses Rippchen.
Engelchen: so nennt man mich —
Meine Seele wie ein Kätzchen
That eins zwei drei vier fünf Sätzchen,
Schwang dann in dies Schiffchen sich:
Ja, sie hat geschwinde Tätzchen.
Engelchen: so nennt man mich —
Jetzt ein Schiff, dereinst ein Mädchen:
Ach, noch immer sehr ein Mädchen:
Denn es dreht um Liebe sich
Stets mein feines Steuerrädchen.
Engelchen: so nennt man mich.
210. An Franz Overbeck in Basel (Typoskript)
Lieber Freund, wahrscheinlich ist Deine Geldsendung schon auf der hiesigen Post: sie hat mir die Ankunft eines recommandirten Briefes gemeldet. Heute bitte ich Dich, die übrigen 250 Francs an Herrn Köselitz zu senden — mit einem Vermerk dass sie von mir kommen. Der Frühling ist hinter uns: wir haben Sommer-Wärme und Sommer-Helligkeit. Es ist die Zeit meiner Verzweiflung. Wohin? wohin? wohin? Ich verlasse so ungern das Meer. Ich fürchte die Berge und alles Binnenländische — aber ich muss fort. Was für Anfälle habe ich wieder hinter mir! Die ungeheuren Mengen Galle, welche ich jetzt immer ausbreche, erregen mein Interesse. Ein Bericht des Berliner Tageblattes über meine Genueser Existenz hat mir Spaass gemacht — sogar die Schreibmaschine war nicht vergessen. Diese Maschine ist delicat wie ein kleiner Hund und macht viel Noth — und einige Unterhaltung. Nun müssen mir meine Freunde noch eine Vorlese-Maschine erfinden: sonst bleibe ich hinter mir selber zurück und kann mich nicht mehr genügend geistig ernähren. Oder vielmehr: ich brauche einen jungen Menschen in meiner Nähe, der intelligent und unterrichtet genug ist, um mit mir arbeiten zu können. Selbst eine zweijährige Ehe würde ich zu diesem Zwecke eingehen — für welchen Fall freilich ein paar andere Bedingungen in Betracht zu ziehen wären. — Rohde hat geschrieben —: ich glaube nicht dass das Bild, welches er sich von mir macht, richtig ist; doch bin ich nicht übel zufrieden damit, dass dies Bild nicht noch viel falscher ist. Aber er ist ausser Stande, etwas von mir zu lernen — er hat kein Mitgefühl für meine Leidenschaft und Leiden. — In Berlin habe ich einen wunderlichen Apostel: denke Dir, dass der Dr. B. Förster in seinen öffentlichen Vorträgen mich in sehr emphatischen Ausdrücken seinen Zuhörern präsentirt. — Rée ist jetzt in Rom: Ende April geht er nach der Schweiz zu seiner Mutter. Er freut sich sehr auf einen Tag in Basel und sendet seine Grüsse voraus.
Lebe wohl, mein lieber Freund — ich bin immer Dein und Euer dankbar ergebener
F.N.
211. An Franz Overbeck in Basel (Postkarte)
Köselitz will das Geld nicht. — Oh, er ist so obstinat! — Die 500 frcs sind in meinen Händen: ich danke Dir, mein lieber Freund. —
Eilig Dein
F. N.
212. An Elise Fincke in Baltimore (Typoskript)
Ja verehrte Frau es giebt noch Einiges von mir zu lesen — mehr noch: Sie haben noch Alles von mir zu lesen. Jene unzeitgemässen Betrachtungen rechne ich als Jugendschriften: Da machte ich eine vorläufige Abrechnung mit dem was mich am meisten bis dahin im Leben gehemmt und gefördert hatte, da versuchte ich von Einigem loszukommen, dadurch dass ich es verunglimpfte oder verherrlichte wie es die Art der Jugend ist —: Ach die Dankbarkeit im Guten und Bösen hat mir immer viel zu schaffen gemacht! Immerhin — ich habe einiges Vertrauen in Folge dieser Erstlinge eingeerntet, auch bei Ihnen und den ausgezeichneten Genossen Ihrer Studien! All dies Vertrauen werden Sie nöthig haben um mir auf meinen neuen und nicht ungefährlichen Wegen zu folgen und zuletzt — wer weiss? wer weiss? — halten auch Sie es nicht mehr aus und sagen was schon mancher gesagt hat: Mag er laufen wohin ihm beliebt und sich den Hals brechen wenn’s ihm beliebt.
Nun verehrte Frau jetzt sind Sie wenigstens gewarnt?
Sie wundern sich dass ich so spät schreibe — ich bin fast blind, und erst seitdem ich diese Schreibmaschine besitze kann ich wieder einen Brief beantworten d. h. seit drei Wochen. Mein Wohnort ist Genua. —
Ihr ergebener Diener
Dr. F. Nietzsche.
213. An Heinrich Köselitz in Venedig (Typoskript)
Mein lieber Freund Möge Alles so sein wie Sie wünschen dass ich glauben möge dass es sei: — Uf! das liesse sich lateinisch besser sagen und in sieben Worten. — Erwägen Sie doch einmal ob Sie nicht mir und zweien meiner Freunde Ihre Matrimonio-Partitur verkaufen wollen? Ich biete Frs. 6000 zahlbar in vier Jahresraten zu Frs. 1500. Die Angelegenheit kann geheim bleiben wenn es Ihr Wunsch ist — Ihrem Herrn Vater dürften Sie sagen dass ein Verleger Ihnen diese Summe geboten habe. — Sodann erwägen Sie was zu thun ist um für das Gefühl der Italiäner die „Impietät“ gegen ihren Classiker Cimarosa aufzuwiegen. Man müsste dazu das Werk der Königin Marguerita empfehlen und ans Herz legen und aus der politischen Lage Gewinn ziehn. Eine deutsche Artigkeit gegen Italien — so müsste es erscheinen. Zu diesem Zwecke könnte freilich die erste Aufführung nur in Rom sein: die Widmung an die Königin dürfte Herrn von Keudell sehr interessant und erwünscht sein. Angenommen dieser Gedanke sagte Ihnen zu — so rathe ich endlich Frl. Emma Nevada für das Werk zu gewinnen: sie hat sich jetzt eben Rom erobert. Die Italiäner sind gegen alle berühmten Sängerinnen sehr artig. Aber passionirt habe ich sie ein einziges Mal gesehn.
Wir haben jetzt die Erste Wiener Operettengesellschaft hier — also deutsches Theater. Ich habe durch sie eine sehr deutliche Vorstellung davon bekommen wie Ihre Scapine beschaffen sein muss. Für weibliche Ausgelassenheit und Grazie scheinen mir die Wienerinnen wirklich erfinderisch zu sein. Sie brauchen für dies Werk wegen seiner armen Handlung lauter erste Süjets. Mir graut vor einer idealistisch anständigen Mittelmässigkeit der Aufführung. — So! Das heisst schwätzen wie ein Theaterdirector — Pardon!
Ich las in R<obert> Mayer: Freund, das ist ein grosser Spezialist — und nicht mehr. Ich bin erstaunt wie roh und naïv er in allen allgemeineren Aufstellungen ist: er meint immer Wunder wie logisch zu sein wenn er bloss eigensinnig ist. Wenn irgend Etwas gut widerlegt ist so ist es das Vorurtheil vom „Stoffe“: und zwar nicht durch einen Idealisten sondern durch einen Mathematiker — durch Boscovich. Er und Copernikus sind die beiden grössten Gegner des Augenscheins: Seit ihm giebt es keinen Stoff mehr, es sei denn als populäre Erleichterung. Er hat die atomistische Theorie zu Ende gedacht. Schwere ist ganz gewiß keine „Eigenschaft der Materie“, einfach weil es keine Materie giebt. Schwerkraft ist, ebenso wie die vis inertiae, gewiß eine Erscheinungsform der Kraft (einfach weil es nichts anderes giebt als Kraft!): nur ist das logische Verhältniß dieser Erscheinungsform zu anderen, zb. zur Wärme, noch ganz undurchsichtig. — Gesetzt aber, man glaubt mit M<ayer> noch an die Materie und an erfüllte Atome, so darf man dann nicht dekretiren: „es giebt nur Eine Kraft“. Die kinetische Theorie muß den Atomen mindestens außer der Bewegungsenergie noch die beiden Kräfte der Cohaesion und der Schwere zuerkennen. Dies thun auch alle materialistischen Physiker und Chemiker! und die besten Anhänger M<ayer>s selber. Niemand hat die Schwerkraft aufgegeben! — Zuletzt hat auch M<ayer> noch eine zweite Kraft im Hintergrunde, das primum mobile, den lieben Gott, — neben der Bewegung selber. Er hat ihn auch ganz nöthig!
Leben Sie wohl oder vielmehr gut, mein lieber Freund!
In Treue Ihr F. N.
214. An Malwida von Meysenbug in Rom (Typoskript)
Mein hochverehrtes Fräulein eigentlich haben wir von einander schon einen letzten Abschied genommen — und es war meine Ehrfurcht vor solchen letzten Worten welche mich für so lange Zeit vor Ihnen stumm gemacht hat. Inzwischen ist Lebenskraft und jede Art von Kraft in mir thätig gewesen: und so lebe ich denn ein zweites Dasein und höre mit Entzücken dass Sie den Glauben an ein solches zweites Dasein bei mir niemals ganz verloren haben. Ich bitte Sie heute recht lange, lange noch zu leben: so sollen Sie auch an mir noch Freude erleben. Aber ich darf nichts beschleunigen — der Bogen in dem meine Bahn läuft ist gross und ich muss an jeder Stelle desselben gleich gründlich und energisch gelebt und gedacht haben: ich muss noch lange lange jung sein, ob ich mich gleich schon den Vierzigern nähere. — Dass jetzt alle Welt mich allein lässt, darüber beklage ich mich nicht — ich finde es vielmehr erstens nützlich und zweitens natürlich. So ist es und war es immer die Regel. Auch Wagners Verhalten zu mir gehört unter diese Trivialität der Regel. Überdiess ist er der Mann seiner Partei; und der Zufall seines Lebens hat ihm eine so zufällige und unvollständige Bildung gegeben dass er weder die Schwere noch die Nothwendigkeit meiner Art von Leidenschaft begreifen kann. Die Vorstellung dass Wagner einmal geglaubt haben kann, ich theilte seine Meinungen, macht mich jetzt erröthen. Zuletzt wenn ich mich über meine Zukunft nicht ganz täusche, wird in meiner Wirkung der beste Theil der Wagnerischen Wirkung fortleben — und das ist beinahe das Lustige an der Sache. - - -
Senden Sie mir ich bitte Sie Ihren Aufsatz über Pieve di Cadore: ich wandele gern Ihren Spuren nach. Vor zwei Jahren habe ich gerade diesen Ort sehnsüchtig ins Auge gefasst. — Glauben Sie dem nicht, was Freund Rée von mir sagt — er hat eine zu gute Meinung von mir — oder vielmehr: ich bin das Opfer seines idealistischen Triebes. —
Von Herzen Ihnen ergeben und immer der Alte noch, wenn auch der Neue
Friedrich Nietzsche.
215. An Paul Rée in Rom (Typoskript)
Mein lieber Freund welches Vergnügen machen mir Ihre Briefe! — Sie ziehen mich ab — nach allen Seiten, und zuletzt unter allen Umständen zu Ihnen hin! — Gestern badete ich am Meere, genau an jener berühmten Stelle wo - - - denken Sie im vorigen Sommer einer meiner nächsten Verwandten von einem solchen Anfall im Bade überrascht wurde und weil zufällig Niemand in der Nähe war ertrank. Über Ihre 30 frs. habe ich sehr gelacht — die Post übergab mir diesen Brief ohne selbst nach meinem Passe zu verlangen — und der junge Beamte lässt Sie grüssen — ecco! — Overbeck hat mir mein Geld geschickt — ich bin für ein paar Monate jetzt versorgt. — Grüssen Sie diese Russin von mir wenn dies irgend einen Sinn hat: ich bin nach dieser Gattung von Seelen lüstern. Ja ich gehe nächstens auf Raub darnach aus — in Anbetracht dessen was ich in den nächsten 10 Jahren thun will brauche ich sie. Ein ganz anderes Capitel ist die Ehe — ich könnte mich höchstens zu einer zweijährigen Ehe verstehen, und auch dies nur in Anbetracht dessen was ich in den nächsten 10 Jahren zu thun habe. — Nach den Erfahrungen die ich eben mit Köselitz mache werden wir ihn nie dazu bringen Geld von uns anzunehmen — es sei denn in der bürgerlichsten Form von Kauf und Verkauf. Ich habe ihm gestern geschrieben ob er mir und zweien meiner Freunde die Matrimonio-Partitur verkaufen wolle —: ich bot ihm 6000 frs. zahlbar in vier Jahresraten von 1500 frs. Diesen Vorschlag halte ich für eine Feinheit und einen Fallstrick —. Sobald er Ja sagt, melde ich es Ihnen; und Sie haben dann die Güte mit Gersdorff zu verhandeln. —
Leben Sie wohl! Die Schreib-maschine will nicht mehr, es ist gerade die Stelle des geflickten Bandes.
Ich schrieb an Frl. v. M<eysenbug> auch wegen Pieve’s.
Meine herzlichsten Wünsche für Ihr Wohl, bei Tag und Nacht
Ihr getreuer Freund F N.
Ich sende den Brief an Frl. von M<eysenbug> Rom poste restante weil ich ihre Adresse nicht habe.
Nein! ich sende den Brief an Frl. v. M. an Ihre Adresse, lieber Freund.
216. An Paul Rée in Rom (Postkarte)
Lieber Freund, das Geld ist angekommen — aber Sie haben sich nicht des cours der salita Battestine erinnert, über den wir übereingekommen waren, und mir 20 lire zuviel geschickt! — Die Schreibmaschine verweigert seit vorgestern den Dienst; ganz rätselhaft! Alles ist in Ordnung! aber kein Buchstabe ist zu erkennen. — Mehrere böse Tage! Ach die verfluchte Wolken-Elektrizität! Soll ich wirklich so verrückt sein, mich wieder den Bergen zu nähern? Am Meere geht es mir doch am erträglichsten. Wo ist aber der Meer-Ort, der Schatten genug für mich hat! è una miseria!
Von Herzen grüßend F. N.
217. An Heinrich Köselitz in Venedig (Typoskript)
Mein lieber Freund Ich habe Frl. Nevada nur als Sonnambula gesehen: ihre sonstigen Opern sind Mignon, Barbier, Faust. Aber die Sängerin der Carmen war Frau Galli-Marié, une personne très jolie, très chic. — Mit meinem Vorschlage möchte ich der Gefahr einer Überarbeitung wenigstens von Einer Seite aus entgegenarbeiten — die erste Rate steht Ihnen zu Gebote, wann Sie wollen. Auf diese Weise würde die von Ihnen so gewünschte Unabhängigkeit von Ihren Verwandten etwas früher erreicht, mindestens angebahnt. Natürlich ist dieselbe Summe zu Ihren Diensten bereit auch ohne „Kauf und Verkauf“ — seien Sie doch unbefangen in diesem Punkte, wie Richard Wagner es auch jetzt noch sein würde: und mit Recht. Mein Vorschlag des Kaufs ist nur eine Nachgiebigkeit gegen Ihre bürgerlichen Vorurtheile. Sie werden mir doch deshalb nicht böse werden? — Mitte nächster Woche reise ich ab: zwei Monate haben Sie dann mindestens vor mir Ruhe. Gott sei Dank — werden Sie sagen.
In Treue
Ihr Freund Nietzsche.
218. An Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Meine liebe Schwester, hier kommt ein kleines Geburtstagsgeschenk, etwas vor der Zeit — aber ich bin im Begriff abzureisen und muß den Moment wahrnehmen. Ich mache Dich hier mit einer ausgezeichneten Frau bekannt, welche nicht nur als Mutter von Frau Cosima Wagner unsre Verehrung verdient. — Das verfluchte Schreiben! Aber die Schreibmaschine ist seit meiner letzten Karte unbrauchbar; das Wetter ist nämlich trüb und wolkig, also feucht: da ist jedesmal der Farbenstreifen auch feucht und klebrig, so daß jeder Buchstabe hängen bleibt, und die Schrift gar nicht zu sehn ist. Überhaupt!! - - - Ich schreibe, sobald ich ein festes Sommerdomizil habe: aber das wird etwas lange vielleicht dauern!
Dein und Euer F.
219. An Franziska und Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Euer Vergnügen über meine Verse hat mir großes Vergnügen gemacht; Ihr wißt, Dichter sind unbändig eitel. Einige weise Reime in altdeutscher Manier haben bei Köselitz den größten Effekt der Verwunderung hervorgebracht. Zuletzt, wenn die Augen mich verhindern etwas zu lernen — ich bin bald so weit! so kann ich immer noch Verse schmieden. — Der letzte Anfall meines Leidens glich vollständig der Seekrankheit: als ich zum Dasein erwachte, lag ich in einem hübschen Bettchen an einem stillen Domplatz; vor meinem Fenster ein Paar Palmen. Hier will ich also den Sommer verleben, ich muß, nach den schlimmen Erfahrungen der letzten Jahre, den Versuch machen, am Meere auch im Sommer zu leben. Die Schatten-Verhältnisse bestimmten meine Wahl. Adresse: Messina (in Sicilia) (poste restante)
In Liebe
Euer F.
220. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Lieber Freund, daß Sie Sich nicht über mich beunruhigen, heute ein Kärtchen — mit der Bitte und Bedingung, daß Sie mir eine gute Zeit keine Briefe, sondern höchstens ebenfalls ein Kärtchen schicken. Also, ich bin an meinem „Rand der Erde“ angelangt, wo, nach Homer, das Glück wohnen soll. In Wahrheit, ich war noch nie so guter Dinge, wie die letzte Woche, und meine neuen Mitbürger verwöhnen und verderben mich auf die liebenswürdigste Weise. Reist vielleicht Jemand mir nach, der die Menschen zu meinen Gunsten besticht? —
Adresse: Messina, Sicilia poste restante.
Mein Sommer-Aufenthalt.
221. An Franz Overbeck in Basel (Postkarte)
Also, lieber Freund! Die Vernunft hat gesiegt: — nachdem mir die letzten Sommer in den Bergen so schlecht bekommen sind, und die Annäherung an die Wolken immer mit Verschlechterung meines Zustandes verbunden war, so bleibt übrig zu versuchen, was ein Sommer am Meere thut. Die Stadt war schwer ausfindig zu machen; zuletzt bin ich mit Einem kühnen Sprunge, direkt, als einziger Passagier, hierher nach Messina gereist, und fange an zu glauben, daß ich mehr Glück als Verstand dabei gehabt habe — denn dies Messina ist wie geschaffen für mich; auch die Messinesen zeigen mir eine Liebenswürdigkeit und Entgegenkommen, daß ich schon auf die wunderlichsten Nebengedanken gerathen bin (zB. ob nicht Jemand hinter mir her reist, der die Leute für mich besticht?) Adresse: Messina, Sicilia, poste restante. Dein guter Brief hat mir zu denken und zu lachen gegeben. Immer Dein und Euer
F. N.
222. An Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Herzlichen Gruß und Glückwunsch! — Von Februar an ist mir Genua nichts nütze mehr: schmerzhafte Unlustigkeit, so daß man mühsam über den Tag wegkommt. Verstärkung der Anfälle. In Recoaro wurde es noch schlimmer. Da scheine ich denn einen vorzüglichen Griff gethan zu haben! Sehr gute Stimmung! Nur verwöhnt man mich! Du kannst errathen, daß ich nicht um zu verschwenden, nach Sicilien gegangen bin, aber die billigen Preise, die man mir macht, setzen mich doch in Erstaunen. Habt Ihr kalt? Die Kalabrischen Berge, meine Vis-à-Vis, haben Schnee! — Wäsche im letzten Zustande! Ich pfeife auf zwei noch möglichen Hemden! Auch meine Kleidung ebenso schlicht als schlecht. Aber mein Zimmer 24 Fuß lang und 20 Fuß breit. Für 4 Pfennige 3 Apfelsinen.
Dein Bruder.
223. An Paul Rée in Locarno
Mein Freund, wie finde ich den mehrerwähnten Goldklumpen, nachdem ich den „Stein der Weisen“ (es ist noch dazu ein Herz) gefunden habe? — — Scirocco immer um mich, mein großer Feind, auch im Metaphorischen Sinne. Zuletzt aber denke ich immer: „ohne Scirocco wäre ich in Messina“ — und vergebe meinem Feinde. — In summa: höchste Gottergebenheit. — Die Reise lächerlich durch und durch, ich will erzählen. Heute direkt nach Basel, wo ich incognito bei Overbecks sein werde, bis Ihr Telegramm mich nach Luzern ruft. Adresse: Nietzsche per adr. Professor Overbeck, Basel, Eulergasse. Die Zukunft ist mir völlig verschlossen, aber doch nicht „dunkel“. Ich muß durchaus Frl. L<ou> noch einmal sprechen, im Löwengarten etwa? — In unbegrenzter Dankbarkeit Ihr Freund N.
224. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz (Postkarte)
Mein werther Herr Verleger, ich hätte Ihnen Mehreres zu erzählen, muß mich aber in Hinsicht auf Augen und fortwährende Kopfschmerzen darauf beschränken, um etwas zu bitten. Senden Sie doch ein Exemplar meiner „Morgenröthe“ unter meiner Adresse nach Zürich poste restante, und umgehend! — Das erste Heft Ihrer Zeitschr<ift> war interessant genug; und zumal die Einleitung setzte mich in einiges Erstaunen, wegen der unerwarteten Gedanken-Harmonie mit mir. Dürfte ich nur lesen, so würde ich weiter lesen! aber der Rest meiner Augen gehört ganz meinem Ziele. Für den Herbst können Sie ein M<anu>s<cript> von mir haben: Titel „Die fröhliche Wissenschaft“ (mit vielen Epigrammen in Versen!!!)
Die besten Wünsche für Sie und Herrn Widemann!
Ergebenst der Ihre
Dr. F. N.
225. An Franziska und Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Es klingt vielleicht unglaublich — aber wahrscheinlich werde ich Mittwoch Nachmittag über Frankfurt zu Euch nach Naumburg kommen.
In Liebe
Euer F.
Abreise Dienstag Abend von Basel
226. An Franz Overbeck in Basel (Postkarte)
In Luzern erwarteten mich Lou und Rée am Bahnhofe. — Wahrscheinlich reise ich Dienstag über Basel nach Naumburg, zusammen mit Rée — prestissimo! - - - Dienstag oder Mittwoch über 2 Wochen kommt Lou einen Tag nach Basel (Abends geht die Reise weiter.) Nachmittags möchte sie gerne zu Dir und Deiner lieben Frau kommen. Ist es erlaubt? —
Herzlich dankbar.
Adr.: Naumburg.
227. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz
Werthester Herr Verleger!
Auch der ernstesten Zeitschrift thut hier und da etwas Heiteres noth. Hier sind 8 Lieder für Ihre Zeitschrift. Meine Bedingungen sind
-
daß sie alle 8 auf Ein Mal gedruckt werden
-
und den Anfang einer Nummer machen, der nächsten womöglich —
-
daß sie mit zierlichen und eleganten Lettern gedruckt werden, nicht mit denen der Prosa-Aufsätze.
Auf meinen „Geschmack“ müssen Sie Sich unbedingt verlassen. — Wollen Sie? Schnelle Rückantwort nach Naumburg a/Saale wo ich ein wenig ausruhe.
Dank für Brief und Sendung nach Zürich!
Ergebensten Gruß an Freund Widemann!
Dr. F. Nietzsche
228. An Franz Overbeck in Basel (Postkarte)
Ein Wort, mein lieber Freund! Inzwischen gieng es mir gut. Schönstes Wetter. In Bezug auf Lou tiefes Stillschweigen. So ist es nöthig. — Der Besuch bei Frau Rée ist jetzt sicher in’s Auge gefaßt, nach Rée’s letzter Karte. — Wir essen den guten Honig und sprechen viel über Dich und Deine verehrungswürdige Gattin. Treugesinnt Dein dankbarer
F N.
229. An Paul Widemann in Dresden (Visitenkarte)
PROF. DR. NIETZSCHE
Herrn Paul Widemann mit herzlichem Gruß und Wunsch
230. An Paul Rée in Stibbe
Lieber Freund, mir ist es inzwischen recht gut ergangen; endlich bin ich dem Scirocco entschlüpft. —
Sehen Sie doch das Maiheft der Schmeitznerschen Zeitschrift an: darin sind „Idyllen aus Messina“. —
Ich habe einen alten Kaufmann, der Bankerott gemacht hat, engagirt: er schreibt täglich 2 Stunden, während meine Schwester das Manuscript diktirt, und ich zuhorche und berichtige: die einzige Rolle, die ich jetzt spielen kann. — Ich bin schweigsam gewesen und werde es auch fürderhin sein — Sie wissen, in Bezug worauf. Es ist nöthig. —
Man kann sich nicht auf wunderbarere Weise Freund sein als wir es jetzt sind, nicht wahr? Mein alter lieber Ree!
Ihr F. N.
231. An Lou von Salomé in Zürich-Riesbach
Liebe Freundin Lou,
besuchen Sie doch Professor Overbeck’s — ihre Wohnung ist Eulergasse 53. —
Hier in Naumburg bin ich bisher in Bezug auf Sie und uns ganz schweigsam gewesen. So bleibe ich unabhängiger und stehe Ihnen besser zu Diensten. —
Die Nachtigallen singen die ganzen Nächte durch vor meinem Fenster. —
Rée ist in allen Stücken ein besserer Freund als ich es bin und sein kann; beachten Sie diesen Unterschied wohl! —
Wenn ich ganz allein bin, spreche ich oft, sehr oft Ihren Namen aus — zu meinem größten Vergnügen!
Ihr F. N.
232. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz (Postkarte)
Der Correctur-Bogen kam einen Tag später als die Karte, welche ihn ankündigte. Ich habe ihn umgehend an Herrn Widemann abgesandt. Für mich wünsche ich 4 Abzüge (bitte dieselben ungebrochen unter Kreuzband zu senden!) Auch möchte ich auf diesen Jahrgang Ihrer Zeitschrift abonniren, zumal meiner Schwester wegen. Ich bleibe noch 3 Wochen in Naumburg: eine Zusammenkunft mit Ihnen, werthester Herr Verleger, in Leipzig — wäre mir sehr erwünscht. Diesmal giebt es freilich kein Köselitzesches Manuscript für die Teubnersche Druckerei. Ich habe einen alten Kaufmann, der banquerott ist, engagirt — meine Schwester und ich diktiren abwechselnd, es ist eine Thierquälerei für mich.
Ihr F. N.
233. An Ida Overbeck in Basel
Verehrte Frau Professor
bei unserem letzten Zusammensein war ich allzu sehr angegriffen: so habe ich Ihnen und meinem Freunde eine Sorge und Beängstigung hinterlassen, zu der eigentlich kein Grund vorliegt; vielmehr Anlaß genug zum Gegentheil! Im Grunde schlägt mir das Schicksal immer zum Glücke und mindestens zum Glücke der Weisheit aus — wie sollte ich mich vor dem Schicksale fürchten, namentlich wenn es mir in der gänzlich unerwarteten Gestalt von L<ou> entgegentritt?
Beachten Sie, daß Rée und ich mit gleichen Empfindungen unsrer tapferen und hochherzigen Freundin zugethan sind — und daß er und ich sehr großes Vertrauen zu einander auch in diesem Punkte haben. Auch gehören wir weder zu den Dümmsten, noch zu den Jüngsten. — Hier habe ich bisher ganz von diesen neuen Dingen geschwiegen. Trotzdem wird dies auf die Dauer unthunlich sein, und zwar schon deshalb, weil meine Schwester und Frau Rée in Verkehr sind. Meine Mutter will ich dagegen „aus dem Spiele“ lassen — sie hat schon genug Sorgen zu tragen — wozu noch unnöthige? —
Fräulein Lou wird diesen Dienstag Nachmittag zu Ihnen kommen (auch das Buch „Schopenhauer als Erzieher“ zurückbringen, welches in der That durch ein Versehen in meinen Koffer gerathen war) Sprechen sie über mich mit jeder Freiheit, verehrte Frau Professor; Sie wissen und errathen ja, was mir, um mein Ziel zu erreichen, am meisten Noth thut — Sie wissen auch, daß ich kein „Mensch der That“ bin und in bedauerlicher Weise hinter meinen besten Absichten zurückbleibe. Auch bin ich, eben wegen des erwähnten Zieles, ein böser böser Egoist — und Freund Rée ist in allen Stücken ein besserer Freund als ich (was Lou nicht glauben will.)
Freund Overbeck darf bei diesem Privatissimum nicht zugegen sein? Nichtwahr? —
Es ging mir inzwischen recht gut; man findet, ich sei in meinem Leben nie so heiter gewesen. Was mag der Grund davon sein?
Treulich dankbar und ganz
der Ihre
F. N.
234. An Lou von Salomé in Zürich-Riesbach
Meine liebe Freundin,
das haben Sie mir recht nach dem Herzen (und auch nach den Augen) geschrieben! Ja, ich glaube an Sie: helfen Sie mir, daß ich immer an mich selber glaube und unserm Wahlspruch und Ihnen Ehre mache
„uns vom Halben zu entwöhnen
„und im Ganzen Guten Schönen
„resolut zu leben“ —
Mein letzter Plan, Sie zu sprechen, ist dieser:
Ich will nach Berlin reisen, in der Zeit, wo Sie in Berlin sein werden, und von da mich sofort in einen der schönen tiefen Wälder zurückziehn, welche in der Nachbarschaft Berlins sind — nahe genug, um uns treffen zu können, wann wir, wann Sie wollen. Berlin selber ist für mich eine Unmöglichkeit. Also: im „Grunewald“ bleibe ich und warte die ganze Zeit ab, welche Sie nachher in Stibbe zubringen. Dann stehe ich Ihnen für alle weitern Absichten zu Gebote: vielleicht finde ich irgend ein würdiges Förster- oder Pfarrhaus im Walde selber, wo Sie noch ein Paar Tage in meiner Nähe leben können. Denn, aufrichtig, ich wünschte sehr, so bald als möglich mit Ihnen einmal ganz allein zu sein. Solche Einsame, wie ich, müssen sich auch an die Menschen, die ihnen die liebsten sind, erst langsam gewöhnen: seien Sie hierin gegen mich nachsichtig oder vielmehr ein wenig entgegenkommend! Gefällt es Ihnen aber, weiter zu reisen, so finden wir nicht weit von Naumburg eine andre Waldeinsiedelei (in der Nachbarschaft eines Altenburgschen Schlosses; dahin könnte ich, wenn Sie wollen, meine Schwester bestellen. (So lange noch alle Sommerpläne in der Luft hängen, thue ich gut, bei den Meinigen ein vollkommnes Stillschweigen aufrecht zu halten — nicht aus Lust an Heimlichkeiten, sondern aus „Kenntniß der Menschen“) Meine liebe Freundin Lou, über „Freunde“ und den Freund Rée insonderheit will ich mündlich mich erklären: ich weiß sehr wohl, was ich sage, wenn ich ihn für einen besseren Freund halte als ich es bin und sein kann. —
Oh der schlechte Photograph! Und doch: was für ein lieblicher Schattenriß sitzt da auf dem Leiterwägelchen! — Den Herbst verbringen wir, denke ich, schon in Wien? Zu welcher Aufführung wollen Sie in Bayreuth sein? Rée hat eine Karte zur ersten, so viel ich weiß. — Nach Bayreuth suchen wir noch einen Zwischenort zu Gunsten Ihrer Gesundheit? Von meiner soll heute nicht die Rede sein.
Von Herzen Ihr F. N.
Man behauptet, ich sei in meinem Leben nicht so heiter gewesen als jetzt. Ich vertraue meinem Schicksale. —
235. An Paul Rée in Stibbe
Mein lieber Freund, wie geht es? Wohin geht es? Und geht es überhaupt? — Was machen die Sommer-Pläne? Gestern habe ich meinen neuesten Plan an L<ou> mitgetheilt: ich will nämlich in einer der nächsten Wochen in den Grunewald bei Charlottenburg übersiedeln und dort so lange verweilen, als L<ou> bei Ihnen in Stibbe ist: um sie dann in Empfang zu nehmen und etwa in einen thüringischen Waldort zu begleiten, wohin eventuell auch meine Schwester kommen könnte. (zB. Schloß Hummelshayn) Bis jetzt, so lange noch Alles schwebt, habe ich Stillschweigen für nöthig befunden.
Haben Sie Ihren Bayreuther Platz schon vergeben? Vielleicht an Lou? Das wäre für die erste Aufführung? — Meine Schwester ist vom 24. Juli an dort.
Gestern war Romundt bei mir, der in der That zu den glücklichen Menschen gehört.
Es ist mir gut gegangen, und ich bin heiter und arbeitsam. — Das M<anu>s<cript> erweist sich seltsamer Weise als „unedirbar“. Das kommt von dem Princip des „mihi ipsi scribo.“ —!
Ich lache öfter über unsre pythagoreische Freundschaft, mit dem sehr seltenen „φίλοις πάντα κοινὰ“. Es giebt mir einen besseren Begriff von mir selber, einer solchen Freundschaft wirklich fähig zu sein. — Aber zum Lachen bleibt es doch?
In herzlicher Liebe Ihr F. N.
Ihrer verehrten Frau Mutter meine und meiner Schwester ergebenste Grüße.
236. An Franz Overbeck in Basel
Mein lieber Freund,
seit mehreren Tagen krank, es gab einen äußerst schmerzhaften Anfall. Ich erhole mich langsam. — Nun Dein Brief! — Einen solchen Brief bekommt man nur Ein Mal, ich danke Dir von ganzem Herzen und werde es Dir nie vergessen. Ich bin glücklich für mein Vorhaben, das für uneingeweihte Augen sehr phantastisch schillern dürfte, den ganzen guten Menschen- und Freundes-Verstand von Dir und Deiner lieben Frau gewonnen zu sehen. Die Wahrheit ist: in der Art, wie ich hier handeln will und werde, bin ich einmal ganz und gar der Mensch meiner Gedanken, ja meines innersten Denkens: diese Übereinstimmung thut mir so wohl, wie mir das Bild meiner Genueser Existenz wohlthut, in der ich auch nicht hinter meinen Gedanken zurückgeblieben bin. Es sind eine Menge meiner Lebensgeheimnisse in diese neue Zukunft eingewickelt, und es bleiben mir hier Aufgaben zu lösen, die man nur durch die That lösen kann. — Übrigens bin ich von einer fatalistischen „Gottergebenheit“ — ich nenne es amor fati — daß ich einem Löwen in den Rachen laufen würde, geschweige denn — —
In Betreff des Sommers ist Alles noch im Unsichersten.
Ich schweige hier fort und fort. In Betreff meiner Schwester bin ich ganz entschlossen, sie außerhalb zu lassen; sie könnte nur verwirren (und sich selber vorerst)
Romundt war hier; brav und etwas mehr auf den Wegen der Vernunft.
Dir und Deiner lieben Frau von Herzen zugethan
F N
237. An Lou von Salomé in Hamburg
Meine liebe Freundin,
auch ich war, gleich Ihnen, recht krank und, wie ich ausgerechnet habe, vom gleichen Tage an; das giebt mir eine Art von bittrer Genugthuung — es ist mir ganz unerträglich, Sie mir allein leidend zu denken.
Von Overbecks kam ein acht Seiten langer Brief an; darin war viel Liebe und Bewunderung für Sie und viel Sorgfalt und Besorgniß für uns Beide. Das ist nichts Geringes, daß der gute Menschenverstand solcher nüchternen und braven Freunde unserem Vorhaben günstig ist. — Sonst halte ich es jetzt für nothwendig, über dieses Vorhaben auch gegen die Nächsten und Besten schweigsam zu sein: weder Frau Rée in Warmbrunn, noch Frl. v. Meysenbug in Bayreuth, noch meine Angehörigen sollen sich über Dinge ihre Köpfe und Herzen zerbrechen, denen wir, wir, wir gewachsen sind und sein werden; während sie für Andere gefährliche Phantastereien sein dürften. —
Für Berlin und Grunewald war ich so bereit, daß ich jede Stunde abreisen konnte. Also erst nach Bayreuth werden wir uns wiedersehn? Und auch dann nur „vielleicht“? Warmbrunn ist kein Ort für mich; auch scheint es mir räthlicher, unsre Dreieinigkeit in diesem Sommer nicht so offen zur Schau zu tragen, wie dies ein Aufenthalt in Warmbrunn mit sich bringen würde: — zum Besten unserer Herbstund Winterpläne. Ich bin in diesem Deutschland viel zu bekannt.
Auch ich habe jetzt Morgenröthen um mich, und keine gedruckten! Was ich nie mehr glaubte, einen Freund meines letzten Glücks und Leidens zu finden, das erscheint mir jetzt als möglich — als die goldene Möglichkeit am Horizonte alles meines zukünftigen Lebens. Ich werde bewegt, so oft ich nur an die tapfere und ahnungsreiche Seele meiner lieben Lou denke.
Schreiben Sie mir immer so wie dieses Mal! Nichts lese ich lieber und leichter als Ihre Hand.
Von ganzem Herzen
Ihr
F. N.
238. An Paul Rée in Stibbe
Inzwischen, mein lieber lieber Freund, war ich krank — ja ich bin es noch. Daher auch heute nur wenig Wörtchen!
Ich halte es nunmehr für festgestellt, daß Frl. Lou bis zur Bayreuther Zeit in Stibbe ist — jedenfalls daß sie mit Ihnen und Ihrer Frau Mutter bis zum angegebenen Termine zusammen bleibt? Ist dies die richtige Auffassung der Lage?
Auf welche Weise wird sie denn nach Bayreuth zu befördern sein? Oder combiniren Sie selber vielleicht Pläne, welche südwärts führen (Engadin?)?
Ich selber denke daran, Anfang Juli mich gewissermaßen nach Wien auf den Weg zu machen: das heißt, einen Sommeraufenthalt in Berchtesgaden zu versuchen — vorausgesetzt, daß ich keinerlei Dienste vorher zu leisten habe. Im Ganzen bitte ich Sie dringend, von unserem Winter-Vorhaben gegen Jedermann zu schweigen: man soll von allem Werdenden schweigen. Sobald etwas zu zeitig davon verlautet, giebt es auch Gegner und Gegen-Pläne: die Gefahr ist nicht gering. —
In Deutschland, merke ich leider, ist es für mich schwer, incognito zu leben. Thüringen habe ich ganz aufgegeben.
Ich möchte möglichst bald hören, was ich zu thun und zu lassen habe, damit ich über meinen Sommer verfügen kann. Naumburg ist ein fürchterlicher Ort für meine Gesundheit.
Adressiren Sie, liebster Freund, Ihre nächsten Zeilen nach Leipzig, poste restante.
Verzeihung für diese vom Geiste der Krankheit überhauchte Schreiberei!
In summa haben wir Beide es doch sehr gut; wer hat denn ein so schönes Projekt vor sich, wie wir?
M<anu>s<cript> ziemlich fertig: aber immer noch unedirbar. Mihi ipsi scripsi.
Adieu!
Von Herzen
Ihr F. N.
239. An Lou von Salomé in Hamburg
Ja, meine liebe Freundin, ich übersehe aus meiner Ferne gar nicht, welche Personen in unsere Absichten nothwendig eingeweiht werden müssen; aber ich denke, wir wollen daran festhalten, eben nur die nothwendigen Personen einzuweihen. Ich liebe die Verborgenheit des Lebens und ich wünschte von Herzen, daß Ihnen und mir ein europäisches Geschwätz erspart bliebe. Im Übrigen verbinde ich mit unserem Zusammenleben so hohe Hoffnungen, daß alle nothwendigen oder zufälligen Nebenwirkungen jetzt wenig Eindruck auf mich machen: und was sich auch ergiebt, wir wollen es zusammen tragen und das ganze Bündelchen alle Abende zusammen in’s Wasser werfen — nicht wahr?
Ihre Worte über Frl. v. M<eysenbug> bestimmen mich, ihr nächstens einen Brief zu schreiben.
Geben Sie mir zu verstehen, wie Sie sich die Zeit von Bayreuth ab einzurichten denken, und auf welche Mithülfe meinerseits Sie dabei rechnen. Mir thut jetzt Berg und Hochwald sehr noth: nicht nur die Gesundheit, noch mehr „die fröhliche Wissenschaft“ treiben mich in die Einsamkeit. Ich will das Ende machen.
Paßt es, wenn ich jetzt schon mich nach Salzburg (oder Berchtesgaden) begebe, also auf den Weg nach Wien?
Wenn wir zusammen sind, schreibe ich Ihnen etwas in das übersandte Buch. —
Zuletzt: ich bin in allen Dingen der That unerfahren und ungeübt; und seit Jahren habe ich mich nie für irgend eine Handlung vor Menschen zu erklären oder zu rechtfertigen gehabt. Meine Pläne lasse ich gerne im Verborgenen; über meine Facta mag alle Welt reden! — Doch gab die Natur jedem Wesen verschiedene Vertheidigungswaffen — und Ihnen gab sie Ihre herrliche Offenheit des Wollens. Pindar sagt einmal „werde der, der du bist!“
Treulich und ergeben
F N.
240. An Lou von Salomé in Hamburg
Nun, liebste Freundin, Sie haben immer für mich ein gutes Wort in Bereitschaft, es macht mir große Freude, Ihnen zu gefallen. Die fürchterliche Existenz der Entsagung, welche ich führen muß und welche so hart ist wie je eine asketische Lebenseinschnürung, hat einige Trostmittel, die mir das Leben immer noch schätzenswerther machen als das Nichtsein. Einige große Perspektiven des geistig sittlichen Horizontes sind meine mächtigste Lebensquelle, ich bin so froh darüber, daß gerade auf diesem Boden unsre Freundschaft ihre Wurzeln und ihre Hoffnungen treibt. Niemand kann so von Herzen sich über alles freuen, was von Ihnen gethan und geplant wird!
Treulich Ihr Freund F.N.
241. An Lou von Salomé in Berlin
Meine liebe Freundin
seit einer halben Stunde bin ich melancholisch und seit einer halben Stunde frage ich mich, warum? — und finde keinen andern Grund als die eben durch Ihren liebwerthesten Brief gemachte Meldung, daß wir uns nicht in Berlin sehen werden.
Nun sehen Sie, was ich für ein Mensch bin! Also: morgen früh um 11 Uhr 40 will ich in Berlin sein, Anhalter Bahnhof. Meine Adresse ist: Charlottenburg bei Berlin, poste restante. Mein Hintergedanke ist 1) - - - und 2) daß ich in einigen Wochen Sie bis nach Bayreuth begleiten darf, vorausgesetzt, daß Sie keine bessere Begleitung finden. — Das heißt sich plötzlich entschließen!
Mit den herzlichsten Grüßen
Ihr Freund N.
Berchtesgaden gilt mir als „widerlegt“. Vorläufig bleibe ich im Grunewald. — M<anu>s<cript> fertig. Durch den größten Esel aller Schreiber!
Ich bringe die Einleitung mit nach Berlin, welche als Überschrift hat „Scherz, List und Rache“ Vorspiel in deutschen Reimen.
242. An Paul Rée in Stibbe
Mein lieber alter Freund, dieses deutsche Wolken-Wetter hat mich zu einer Art von Siechthum verurtheilt, so daß auch meine Vernunft mitunter nicht mehr vernünftig blieb — Zeugniß mein letzter Brief, für dessen schnelle Beantwortung ich Ihnen von Herzen gut bin.
Zeugniß zweitens meine Reise nach Berlin, um L<ou> und den Grunewald zu sehn; doch habe ich nur das Zweite erreicht — auf Nimmerwiedersehn! Am Tage drauf fuhr ich nach Naumburg zurück — halbtodt. — Ebenso wurde aus dem projektirten Aufenthalt in Leipzig nichts; ich hielt es auch nur Einen Tag aus.
Trotzalledem bin ich voller Zutrauen zu diesem Jahre und seinem geheimnißvollen Würfelspiel über mein Schicksal.
Ich reise nicht nach Berchtesgaden und bin überhaupt nicht mehr im Stande, allein etwas zu unternehmen. In Berlin war ich wie ein verlorner Groschen, den ich selber verloren hatte und Dank meiner Augen nicht zu sehn vermochte, ob er mir schon vor den Füßen lag, so daß alle Vorübergehenden lachten.
Gleichniß! —
Was wird nach Bayreuth? Ich combinire jetzt, daß auch meine Mutter Frl. Lou einladen könnte, daß sie etwa den Monat August in Naumburg zubrächte, und daß wir im September uns auf den Weg nach Wien machten. Sagen Sie Ihre Meinung, bitte.
Ich lege ein Billet an unsre sehr merkwürdige und allzusehr liebenswürdige Freundin bei; ich weiß nicht, wo sie ist. —
Ihrer verehrten Frau Mutter meinen Gruß und Dank — Sie wissen ja, wofür ich ihr gerade jetzt solchen Dank schuldig bin.
Von Herzen Ihr
Freund N.
243. An Lou von Salomé in Stibbe
Liebe Freundin
Also: ich habe eine kleine anscheinend sehr thörichte Reise nach Berlin gemacht, bei der mir Alles mißrieth; Tags darauf fuhr ich zurück, über den Grunewald und mich selber etwas aufgeklärter als sonst — ein wenig hohnlachend und sehr erschöpft. —
Heute aber bin ich schon ganz wieder in meine fatalistische „Gott-Ergebenheit“ zurückverfallen und glaube von Neuem, daß mir Alles zum Besten gereichen muß sogar diese Berliner Reise und ihre Quintessenz (ich meine das Faktum, daß ich Sie nicht gesehen habe)
Ich möchte so gerne bald mit Ihnen etwas arbeiten und studiren und habe schöne Dinge vorbereitet — Gebiete, in denen Quellen zu entdecken sind, vorausgesetzt daß Ihre Augen gerade da Quellen entdecken wollen (— die meinen sind nicht mehr frisch genug dazu!) Sie wissen doch, daß ich wünsche, Ihr Lehrer zu sein, Ihr Wegweiser auf dem Wege zur wissenschaftlichen Produktion? —
Was denken Sie über die Zeit nach Bayreuth? Was wäre Ihnen das Erwünschteste, Zuträglichste und Erstrebenswertheste eben für diesen Zeitraum? — Und ist für den Beginn unsrer Wiener Existenz der September ins Auge zu fassen?
Meine Reise belehrte mich wieder über mein unsägliches Ungeschick, sobald ich neue Orte und Menschen um mich fühle —: ich glaube, die Blinden sind zuversichtlicher als die Halb-Blinden. Mein Wunsch in Betreff Wiens ist jetzt, wie ein Paquetstück in ein Zimmerchen des Hauses abgesetzt zu werden, in welchem Sie wohnen wollen. Oder im Hause nebenan, als
Ihr getreuer Freund und
Nachbar F.N.
244. An Heinrich Köselitz in Venedig
Mein lieber alter Freund, ein seltsames Jahr! Ganz äußerlich schon sieht es närrisch genug aus: denken Sie, daß ich von Messina nach dem Berliner Grunewalde gereist bin, der mir als Aufenthalt für den Sommer von einem schweizerischen Forstmann empfohlen wurde. Ich fand freilich hier nicht, was ich suchte — und bin jetzt wieder in Naumburg. Inzwischen ist aber allerlei Wesentliches geschehen oder vorbereitet — und ich sehe mit Staunen dem sonderbaren Würfelspiele zu und warte und warte. Denn es muß mir Alles zum Besten gereichen: ich lebe ganz in einer fatalistischen „Gott-Ergebenheit“. — Genaueres läßt sich nicht schreiben.
Heute frage ich an, ob Sie mir bei der Correktur der „fröhlichen Wissenschaft“ — meines letzten Buches, wie ich annehme — helfen können (vom „Wollen“ rede ich nicht, mein alter Getreuer!) Aufrichtigkeit bis zum Tod! Nichtwahr?
Die Quälerei der M<anu>s<cript>-Herstellung, mit Hülfe eines banquerotten alten Kaufmanns und Esels, war außerordentlich: ich habe es verschworen, dergleichen nochmals über mich ergehen zu lassen.
Ich habe zehnmal auch dieses Buch für unedirbar gehalten und zehnmal wieder mich von diesem Glauben bekehrt. Jetzt denke ich so: es liegt gar nichts daran, was meine jetzigen Leser über dieses Buch und über mich denken, — aber es liegt etwas daran, daß ich so von mir gedacht habe, wie in diesem Buche zu lesen ist: sei es auch nur, um vor mir selber zu warnen.
Vom Herbste an beginne ich eine neue Studenten-Zeit: ich gehe an die Universität Wien.
Kommen Sie nach Wien? Ach, ich kann es Ihnen nicht sagen, wie ich es entbehre, Sie nicht um mich zu haben.
Die Einsiedelei des Lebens ist gar zu groß und wird immer größer. —
Und Ihre Musik! In Basel ließ ich mir drei Mal Ihr „Nacht du holde“ vorspielen — und hatte lange, lange nicht genug. Und ebenso jene allerfröhlichsten 8 Takte
Adieu, mein lieber Freund!
F.N.
245. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz (Postkarte)
Mein werther Herr Verleger, meine unberechenbare Gesundheit und das ebenso unlogische Sommer-Wetter haben alle meine guten Absichten über den Haufen geworfen. (ZB. wollte ich ein paar Wochen in Leipzig sein und dachte Sie da zu sehen.) — In den nächsten Tagen bekommen Sie den ersten Theil M<anu>s<cript> der „fröhlichen Wissenschaft“ — ich bitte dringend darum, daß der Druck bei Teubner sofort beginnt.
Für Honorar und Exemplare meinen besten Dank.
Ergebenst
Prof Nietzsche.
246. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz (Telegramm)
Bitte morgen elf Uhr Leipzig Nürnbergerstrasse 6. 1 Treppe
Nietzsche
247. Vermutlich an Paul Rée in Stibbe <Entwurf>
Allen Ernstes, so ist es besser. Auf die Dauer wäre mein Stillschweigen unmäglich gewesen; es war nur für die allernächste Zeit nöthig, wie ich es auch mit Overbecks vereinbarte. Ich selber mußte erst meinen Angehörigen wieder etwas „angehören“, nach vieler, langer und sonst innerlicher Trennung. Von vornherein wäre ich ihnen mit einem solchen Unterfangen (wie unsere Wiener Pläne) ganz unverständlich gewesen; (sie würden an eine verrückte Idee oder Leidenschaft geglaubt haben)
248. An Franz Overbeck in Basel (Postkarte)
Lieber Freund, morgen verlasse ich Naumburg; meine Adresse ist: Dorf Tautenburg bei Dornburg (Thüringen). — Dir wohlbekannt! — Teubner druckt bereits an der „fröhlichen Wissenschaft“; Köselitz hilft corrigieren. Die Herstellung des M<anu>s<cripts> für die Druckerei war peinlich; hoffentlich für lange Jahre zum letzten Male! — Frl. L<ou> ist bei Frau Rée in Stibbe, guter Dinge wie wir Alle. Den 24. Juli wird sie in Bayreuth sein. Die Übersiedelung nach Wien erfolgt wohl schon im September; hast Du etwas in Aussicht, in Betreff der Wohnung von Frl. L<ou>? — Das Geld möchte ich jetzt nicht haben; wenn Du in Deutschland bist, wird es dafür noch Zeit sein. — Romundt fand ich gefaßt, muthig und voller Pläne, übrigens viel vernünftiger und angenehmer als ich erwartete. — Deiner lieben Frau das Herzlichste!
F.N.
249. An Lou von Salomé in Stibbe
Meine liebe Freundin,
eine halbe Stunde abseits von der Dornburg, auf der der alte Goethe seine Einsamkeit genoß, liegt inmitten schöner Wälder Tautenburg. Da hat mir meine gute Schwester ein idyllisches Nestchen eingerichtet, das mich nun diesen Sommer bergen soll. Gestern habe ich es in Besitz genommen; morgen reist meine Schwester ab, und ich werde allein sein. Doch haben wir etwas verabredet, was sie vielleicht wieder hierher bringt. Gesetzt nämlich, Sie hätten keine bessere Verwendung des Monat August’s und fänden es schicklich und thunlich, hier mit mir im Walde zu leben, so würde meine Schwester Sie von Bayreuth hierher geleiten und mit Ihnen hier in Einem Hause wohnen (zb. bei dem Pfarrer, wo sie augenblicklich wohnt: der Ort hat Auswahl an hübschen bescheidenen Zimmern) Meine Schwester, über die Sie Rée befragen mögen, würde gerade für diese Zeit nach Abgeschiedenheit verlangen, um auf ihren kleinen Novellen-Eierchen zu brüten. Es ist ihr ein äußerst angenehmer Gedanke, in Ihrer und meiner Nähe zu sein. — So! Und nun Aufrichtigkeit „bis zum Tod“! Meine liebe Freundin! Ich bin durch nichts gebunden und wechsele meine Pläne, wenn Sie Pläne haben, auf das Leichteste. Und soll ich nicht mit Ihnen zusammen sein, so sagen Sie auch dies mir einfach — und nicht einmal Gründe brauchen Sie anzugeben! Ich vertraue Ihnen ganz: aber das wissen Sie. —
Wenn wir zu einander passen, so werden auch unsre Gesundheiten zu einander passen, und irgendworin wird ein geheimer Nutzen sein. Ich habe bisher nie daran gedacht, daß Sie mir „vorlesen und schreiben“ sollen; aber ich wünschte sehr, Ihr Lehrer sein zu dürfen. Zuletzt, um die ganze Wahrheit zu sagen: ich suche jetzt nach Menschen, welche meine Erben sein könnten; ich trage Einiges mit mir herum, was durchaus nicht in meinen Büchern zu lesen ist — und suche mir dafür das schönste und fruchtbarste Ackerland.
Sehen Sie meine Selbstsucht! —
Wenn ich hier und da an die Gefahren Ihres Lebens, Ihrer Gesundheit denke: da füllt sich meine Seele jedesmal ganz von Zärtlichkeit; ich wüßte nichts, was mich so schnell Ihnen nahe brächte. — Und dann bin ich immer glücklich, zu wissen, daß Sie Rée und nicht nur mich zum Freunde haben. Sie Beide mir zusammen spazierengehend und redend zu denken ist mir ein wahrer Genuß. —
Der Grunewald war viel zu sonnig für meine Augen.
Meine Adresse ist: Tautenburg bei Dornburg, Thüringen.
Treulich Ihr
Freund Nietzsche.
Gestern war Liszt hier.
250. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Ich danke Ihnen von Herzen für Ihren Brief; es thut nichts, wenn einmal „das wilde Thier“ den Kopf durch den Käfig steckt — zuletzt haben wir, Sie und ich, unsre göttlich-lustigen und sehr unthierischen Stunden, derentwegen es doch werth ist zu leben — nicht wahr, alter Freund?
Meine Adresse ist: Dorf Tautenburg bei Dornburg (Thüringen).
Tautenburg liegt in Wäldern versteckt. — Kommen Sie nach Bayreuth!
Treulich der Ihre F.N.
251. An Lou von Salomé in Stibbe
Liebe Freundin
wie freue ich mich, vom guten Schiffe zu hören, daß es in den guten Hafen eingelaufen ist! Augenblicklich werden wir Alle Drei zu den zufriedensten Menschen gehören, die es giebt. Dieses Tautenburg entzückt mich und paßt zu mir in allem und jedem; und nochmals fühle ich mich in diesem wunderbaren Jahre durch ein unerwartetes Geschenk des Schicksals überrascht. Für meine Augen und meine einsamen Neigungen ist hier das Paradies; ich verstehe den Wink, daß die Zeit meiner Südländerei vorüber ist; die Reise von Messina bis Grunewald war ein dicker Strich unter diese Vergangenheit.
Inzwischen habe ich alles, was Sie betrifft, meiner Schwester mitgetheilt. Ich fand sie, in der langen Trennungszeit, so gut fortgeschritten und ausgewachsener als früher, alles Vertrauens würdig und sehr liebevoll gegen mich. Ihre eigenen Pläne für den Winter sind inzwischen festgestellt (sie geht nach Genua, in meine dortige Wohnung, später nach Rom); meine Besorgniß, dieselben möchten sich mit meinen Wiener Plänen kreuzen, ist damit gehoben. Übrigens hat sie jetzt ihre eignen Neigungen zur Abgezogenheit und „Unbeeinflußtheit“ — und so glaube ich in summa, daß Sie es mit ihr und uns versuchen dürfen. — Aber meine ganze Stillschweigerei war nicht nöthig, werden Sie jetzt meinen? Ich analysirte sie heute und fand als letzten Grund: Mißtrauen gegen mich selber. Ich bin nämlich durch das Ereigniß, einen „neuen Menschen“ hinzuerworben zu haben, förmlich über den Haufen geworfen worden — in Folge einer allzustrengen Einsamkeit und Verzichtleistung auf alle Liebe und Freundschaft. Ich mußte schweigen, weil mich von Ihnen zu reden jedesmal umgeworfen hätte (es passirte mir bei den guten Overbecks) Nun, das erzähle ich Ihnen zum Lachen. Es geht bei mir immer sehr menschlich-allzumenschlich zu und meine Thorheit wächst mit meiner Weisheit.
Dies erinnert mich an meine „fröhliche Wissenschaft.“ Donnerstag kommt der erste Correcturbogen, und Sonnabend soll der letzte Theil des M<anu>s<cripts> in die Druckerei abgehen. Ich bin jetzt immer von sehr feinen Sprachdingen occupirt; die letzte Entscheidung über den Text zwingt zum scrupulösesten „Hören“ von Wort und Satz. Die Bildhauer nennen diese letzte Arbeit „ad unguem.“ — Mit diesem Buche kommt jene Reihe von Schriften zum Abschluß, die mit „Menschl<ichem,> Allzum<enschlichem>“ beginnt: in allen zusammen soll „ein neues Bild und Ideal des Freigeistes“ aufgerichtet sein.
Daß dies nun freilich nicht „der freie Mensch der That“ ist, werden Sie längst errathen haben. Vielmehr — doch hier will ich schließen und lachen. Von Herzen Ihnen
und Freund Rée zugethan F.N.
252. An Heinrich Köselitz in Venedig
An den Schmerz.
Wer kann dich fliehn den du ergriffen hast,
Wenn du die ernsten Blicke auf ihn richtest?
Ich will nicht flüchten, wenn du mich erfaßt,
Ich glaube nimmer, daß du nur vernichtest!
Ich weiß, durch jedes Erden-Dasein mußt du gehn,
Und nichts bleibt unberührt von dir auf Erden:
Das Leben ohne dich — es wäre schön,
Und doch — auch du bist werth, gelebt zu werden!
Gewiß, du bist nicht ein Gespenst der Nacht,
Du kommst, den Geist an seine Kraft zu mahnen:
Der Kampf ist’s, der die Größten groß gemacht,
Der Kampf um’s Ziel, auf unwegsamen Bahnen.
Und drum, kannst du mir nur für Glück und Lust
Das Eine, Schmerz, die ächte Größe geben,
Dann komm und laß uns ringen, Brust an Brust,
Dann komm und sei es auch um Tod und Leben —
Dann greife in des Herzens tiefsten Raum,
Greif ein in’s tiefste Innere des Lebens,
Nimm hin der Täuschung und des Glückes Traum,
Nimm, was nicht werth war unbegrenzten Strebens.
Des ächten Menschen Sieger bleibst du nicht,
Ob er auch deinem Streich die Brust entblöße,
Ob er im Tode auch zusammen bricht: —
— Du bist der Sockel für des Geistes Größe!
253. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Pardon, Freund! Teubner (oder Schmeitzner?) macht Alles falsch. Das M<anu>s<cript> soll an Sie! Die Verse sind gräßlich durch Drucker und Setzer mißhandelt: ich schäme mich, daß Sie dies unverständliche Zeug zu sehen bekommen.
Adresse immerfort: Dorf Tautenburg bei Dornburg (Thüringen) —
In Freundschaft F. N.
Um des Himmels willen Ihre Orthographie und Interpunktion und keine stäts! Oder?
254. An Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Bis jetzt krank, schwerer Anfall. — Zu Bett. Gewitter über Gewitter. Morgenschuh gefunden. Es fehlt Zucker und Salz. Auch etwas Fleischextrakt wäre nützlich, namentlich nach den Anfällen. Der Pfarrer war 2mal hier. Ja keine Gedanken in <den> Kopf setzen von wegen „Mißtrauen einflößen!“ Fehlt aller Grund dazu! Sonst alles recht so! — Selter<s>wasser sehr wohlthuend. Der Barbier ist nicht ganz ungefährlich.
Unsrer Mutter die herzlichsten Grüße.
Dein treuer Bruder FN
Parsifal: Seite 56—93 (nur zu lang!), vom vorletzten Takt 231 bis Mitte 238 Klavierauszug
255. An Elisabeth Nietzsche in Naumburg
Hier, meine liebe Schwester, ist der Brief Lou’s. —
In Betreff Deiner Winterpläne und ihrer völligen Unabhängigkeit will ich selber brieflich antworten. — Es scheint also, daß Alles sehr schön gelingt. Schreibe an den Pfarrer.
Diese Federn sind fürchterlich, eine wie die andre. Erweise mir die Gunst, durch Dr. Romundt ein Gros von der Humboldfeder Roeder’s B kommen zu lassen. Es ist die einzige Feder, mit der ich noch schreiben kann.
Manuscript ganz fertig. Große und siegreiche Empfindung, in Hinsicht auf 6 Jahre!
Drei Bogen Correctur in meinen Händen.
Danke sehr für die Kirschen! Ich aß seit dem keine Erdbeeren. Alle Abende um 6 bin ich im Wirthshause, seit dem der Anfall vorüber ist.
Mache doch eine Nota für mich und die verschiedne Sendungen. —
Aber jetzt wirst Du doch an Lou schreiben?
Von ganzem Herzen
dankbar
Dein Bruder
F. N.
(sehr guter Dinge!)
256. An Lou von Salomé in Stibbe
Meine liebe Freundin,
Nun ist der Himmel über mir hell! Gestern Mittags gieng es bei mir zu wie als ob Geburtstag wäre: Sie sandten Ihre Zusage, das schönste Geschenk, das mir jetzt Jemand hätte machen können — meine Schwester sandte Kirschen, Teubner sandte die drei ersten Druckbogen der „fröhlichen Wissenschaft“; und zu alledem war gerade der allerletzte Theil des Manuscriptes fertig geworden und damit das Werk von 6 Jahren (1876—1882), meine ganze „Freigeisterei“! Oh welche Jahre! Welche Qualen aller Art, welche Vereinsamungen und Lebens-Überdrüsse! Und gegen Alles das, gleichsam gegen Tod und Leben, habe ich mir diese meine Arznei gebraut, diese meine Gedanken mit ihrem kleinen kleinen Streifen unbewölkten Himmels über sich: — oh liebe Freundin, so oft ich an das Alles denke, bin ich erschüttert und gerührt und weiß nicht, wie das doch hat gelingen können: Selbst-Mitleid und das Gefühl des Sieges erfüllen mich ganz. Denn es ist ein Sieg, und ein vollständiger — denn sogar meine Gesundheit des Leibes ist wieder, ich weiß nicht woher, zum Vorschein gekommen, und Jedermann sagt mir, ich sähe jünger aus als je. Der Himmel behüte mich vor Thorheiten! — Aber von jetzt ab, wo Sie mich berathen werden, werde ich gut berathen sein und brauche mich nicht zu fürchten. —
Was den Winter betrifft, so habe ich ernstlich und ausschließlich an Wien gedacht: die Winterpläne meiner Schwester sind ganz unabhängig von den meinigen, es giebt dabei keine Nebengedanken. Der Süden Europa’s ist mir jetzt aus dem Sinn gerückt. Ich will nicht mehr einsam sein und wieder lernen, Mensch zu werden. Ah, an diesem Pensum habe ich fast Alles noch zu lernen! —
Nehmen Sie meinen Dank, liebe Freundin! Es wird Alles gut, wie Sie es gesagt haben.
Unserem Rée das Herzlichste!
Ganz Ihr
F.N.
257. An Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Parterre-Zimmer des Pfarrers sind vielleicht doch bequemer?
Die 5 Damen aus Merseburg, welche er gerne hier oben hätte, sind, wenn ich recht verstanden habe, Frau von Häsler mit 2 Töchtern und Gouvernante und Frau von Bergsdorff. Oder? —
Herzlichste Grüße
FN.
258. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz (Postkarte)
Werthester Herr, heute soll der Rest des M<anu>s<cripts> zur Post, und zwar direkt in die Druckerei, damit keine Zeitversäumniß entsteht. Bis jetzt habe ich 3 Correktur-Bogen.
Von unserem Leipziger Zusammentreffen habe ich einen angenehmen Nachgeschmack; es war nur allzu kurz! —
Meine Adresse ist für den Sommer: Tautenburg bei Dornburg, Thüringen.
Meine besten Wünsche für alle Ihre Unternehmungen!
Ihr Nietzsche.
259. An Franziska Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Meine liebe Mutter, gerade heute Mittag hatte ich solchen Appetit nach Kirschen - und siehe, als ich nach Hause kam, standen sie da! Ich war in Dornburg, wie auch schon gestern: um Teubnersche Verwirrungen durch Telegramme wieder zurechtzubringen. Regenwetter, Sumpfland, Geduld! Trotzdem ist Tautenburg auf die Dauer das Rechte, und es ist wichtig, daß wir es so nah bei Naumburg gefunden haben — in Hinsicht auf spätere Zeiten. Ich will den Sommer hier bleiben. Da beißt mich eben ein Floh. In Dornburg kann ich übrigens Alles haben, was ich noch wünschte (zb. Liebig, auch Caffé und Salz) also wollen wir Naumburg lassen. Immer mit Dankbarkeit Deiner schönen Pflege gedenkend
Dein F.
260. An Elisabeth Nietzsche in Naumburg
Meine liebe Schwester, nun, ich will nur nicht aus der Haut fahren, aus Verdruß über die Post.
Also: ich schrieb Sonntags nach Ankunft des Naumburger Pakets sofort an Dich; auch an unsre Mutter eine Karte, ich war Euch so dankbar! Montag morgen mußte mein Geschriebenes in Euren Händen sein.
Die Hauptsache ist: ich hatte den liebenswürdigen Zusage-Brief Lou’s in den Brief an Dich eingelegt; es war so viel auch von Dir darin die Rede, in einer Weise, die Dir sehr viel Vergnügen machen mußte. Sie ist ganz und gar einverstanden und will 4 Wochen in Tautenburg bleiben. Es ärgert mich aus 100 Gründen, daß du diesen Brief nicht lesen kannst. Aber schreib ihr jetzt und laß das Brief-Malheur und den Brief unerwähnt. Inzwischen will ich Alles thun, ihn aufzutreiben. Die Post ist für mich hier das Unerträgliche. Ich habe täglich Noth damit gehabt und muß schließlich immer selber in Dornburg verhandeln. Teubner hat 6 Bogen bisher gedruckt; wie ich aber die Correcturen mit Köselitz über Tautenburg zu Stande bringe, begreife ich noch nicht. Und dabei kann immer noch etwas verloren gehen! —
Im Übrigen bin ich sehr guter Dinge (obwohl nicht gerade guter Gesundheit — es ist zu viel Gewitter in der Luft, Tag für Tag!)
Mit diesem Post-Malheur bin ich äußerst unzufrieden, meine Absicht war, Dich so schnell wie möglich aus der Spannung zu erlösen — und das Gegentheil ist passirt! — —
Bitte, um des Himmels Willen: Stahlfedern! Die Naumburger also: B. John Mitchells classical 689! Später mag mir Dr. Romundt die mir allein nützliche Humboldfeder B (Roeders) schaffen.
Alle sonstigen Bedürfnisse zb. Caffé Salz kann ich bequem mir selber besorgen, auch Liebigs Extrakt.
In herzlicher Liebe Dein und Euer
F N.
261. An Franziska Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Meine liebe Mutter, soeben bekomme ich Deine Sendung; inzwischen wirst Du gehört haben, daß meine letzte Karte des Dankes an Dich verloren gegangen ist. Immerfort Regenwetter und dazwischen plötzliche Hitze und Gewitter-Aufziehn: sehr übles Wetter für meinen Kopf! Mehrere Tage bin ich die Kopfschmerzen nicht losgeworden, auch heute nicht. Sonst gefällt mir Alles hier wohl, namentlich Haus und Wirthe, ebenfalls die Kost im Gasthof (Abends um 6) Auch saure Milch bekommt mir sehr gut. Mach doch eine Nota für mich! Mit den herzlichsten Wünschen und Grüßen Dein Sohn.
262. An Franziska Nietzsche in Naumburg
Meine liebe Mutter,
Sonntag war ich krank. — Es giebt viel zu thun. Große Verzögerung der Drucksache. —
Neulich, als ich von Dir gieng, traf ich auf dem Bahnhofe den Oberpfarrer mit Suschen; großes Gelächter.
Heute eine Bitte und ein wenig dringlich!
Der Verschönerungs Verein hat mir hier zwei neue Bänke in den Theilen des Waldes aufstellen lassen, wo ich gerne allein spazieren gehe. Ich habe versprochen, zwei Täfelchen daran anbringen zu lassen. Willst Du die Güte haben und dies besorgen? Und sofort? Sprich mit einem Sachverständigen, welche Art von Täfelchen und Aufschriften sich am besten hält.
Auf dem einen soll stehen:
Der todte Mann.
F.N.
Auf dem andern:
Die fröhliche Wissenschaft.
F.N.
Es muß etwas Feines und Hübsches sein, das mir Ehre macht. Mit herzlichem Gruß
Dein Sohn Fritz.
263. An Heinrich Köselitz in Venedig
Mein lieber Freund,
keine Worte höre ich lieber aus Ihrem Munde als „Hoffnung“ und „Erholung“ — und nun mache ich Ihnen diese größliche Correktur-Noth gerade in diesem Zustande, wo es paradiesisch um Sie zugehen sollte!
Kennen Sie meine Harmlosigkeiten aus Messina? Oder schwiegen Sie darüber, aus Artigkeit gegen ihren Urheber? — Nein, trotz dem, was der Vogel Specht in dem letzten Gedichtchen sagt — es steht mit meiner Dichterei nicht zum Besten.
Aber was liegt daran! Man soll sich seiner Thorheiten nicht schämen, sonst hat unsre Weisheit wenig Werth.
Jenes Gedicht „an den Schmerz“ war nicht von mir. Es gehört zu den Dingen, die eine vollständige Gewalt über mich haben, ich habe es noch nie ohne Thränen lesen können; es klingt wie eine Stimme, auf welche ich seit meiner Kindheit gewartet und gewartet habe. Dieses Gedicht ist von meiner Freundin Lou, von welcher Sie noch nicht gehört haben werden. Lou ist die Tochter eines russischen Generals, und zwanzig Jahre alt; sie ist scharfsinnig wie ein Adler und muthig wie ein Löwe und zuletzt doch ein sehr mädchenhaftes Kind, welches vielleicht nicht lange leben wird. Ich verdanke Sie Fräulein von Meysenbug und Rée. Jetzt ist sie bei Rées zu Besuch, nach Bayreuth kommt sie zu mir nach Tautenburg, und im Herbst siedeln wir zusammen nach Wien über. Wir werden in Einem Hause wohnen und zusammen arbeiten; sie ist auf die erstaunlichste Weise gerade für meine Denk- und Gedankenweise vorbereitet.
Lieber Freund, Sie erweisen uns Beiden sicherlich die Ehre, den Begriff einer Liebschaft von unserem Verhältniß fernzuhalten. Wir sind Freunde und ich werde dieses Mädchen und dieses Vertrauen zu mir heilig halten. — Übrigens hat sie einen unglaublich sicheren und lauteren Charakter und weiß selbst sehr genau, was sie will — ohne die Welt zu fragen und sich um die Welt zu bekümmern.
Dies für Sie und für Niemanden sonst. Aber wenn Sie nach Wien kämen, wäre es schön!
Zuletzt: was sind denn bisher meine werthvollsten Menschen-Funde? Sie — dann Rée — dann Lou.
In treuer Gesinnung
Ihr Freund F. N.
264. An Malwida von Meysenbug in Mezzaratte bei Bologna (Entwurf)
Mögen Sie jetzt in der Nähe von Olga und ihren Kindern eine ruhig-tröstliche Sonnenzeit haben; möge namentlich das Zusammensein mit dieser geliebten Seele alle jene Befürchtungen zerstreuen oder mildern, welche Sie mir in Rom ausdrückten; dies und gar nichts Anderes wüßte ich Ihnen zu wünschen — alles Andre haben Sie ja!
Ich sitze hier inmitten tiefer Wälder und habe eben die Correctur meines letzten Buches zu besorgen; es führt den Titel „die fröhl. W<issenschaft“> und bildet den Schluß jener Gedanken-Kette, welche ich damals in Sorrent zu knüpfen anfieng ach, ich war immer ein solcher Bücher-Verächter und bin nun selber „der Sünde bloß“ oder wie sagt Gretchen? — mit 10 Büchern! Die nächsten Jahre werden keine Bücher hervorbringen — aber ich will wieder, wie ein Student, studiren. (Zunächst in Wien.)
Mein Leben gehört jetzt einem höheren Ziele und ich thue nichts mehr, was dem nicht frommt. Errathen kann es Keiner und verrathen darf <ich> es jetzt selber noch nicht! Aber daß es eine heroische Denkweise verlangt (und durchaus keine religiös-resignirte), will ich Ihnen, und Ihnen gerade am liebsten eingestehen. Wenn Sie M<enschen> mit dieser Denkweise entdecken, so geben Sie mir einen Wink: wie Sie es mit der jungen Russin gethan haben. Diese<s> Mädchen ist mit mir jetzt durch eine feste Freundschaft verbunden (so fest man dergl. eben auf Erden einrichten kann); ich habe seit langem keine bessere Errungenschaft gemacht. Wirklich ich bin Ihnen und Rée außerordentlich dankbar gestimmt, mir hierzu behülflich gewesen zu sein. Dieses Jahr, welches in mehreren Hauptstücken meines Lebens eine neue Crisis bedeutet (Epoche ist das richtige Wort, ein Mittelzustand zwischen 2 Crisen, eine hinter mir eine vor mir) ist mir durch den Glanz und die Anmuth dieser jungen, wahr<haft> heroischen Seele sehr verschönt worden. Ich wünsche in ihr eine Schülerin zu bekommen, und wenn es mit meinem Leben auf die Länge nicht halten sollte, eine Erbin und Fortdenkerin.
Beiläufig: Rée hätte sie heirathen sollen (um die mancherlei Schwierigkeiten ihrer Lage zu beseitigen); und ich meinerseits habe es wahrlich nicht an Zuspruch fehlen lassen. Aber es scheint mir jetzt eine verlorne Bemühung. Er ist in Einem letzten Punkte unerschütterlicher Pessimist, und wie er sich hierin treu geblieben ist, gegen alle Einwände seines Herzens und meiner Vernunft, hat mir zuletzt doch großen Respekt eingeflößt. Der Gedanke der Fortpflanzung der Menschheit ist ihm unerträglich: er bringt es nicht über sein Gefühl, die Zahl der Unglücklichen zu vermehren. Für meinen Geschmack hat er in diesem Punkte zu viel Mitleid und zu wenig Hoffnungen. Alles privatissime!
In Bayreuth werden manche meiner Freunde sich bei Ihnen einstellen und Ihnen wohl auch ihre Hintergedanken über mich einst verrathen; sagen Sie diesen Freunden allesamt, daß man es mit mir abwarten müsse und daß kein Grund zum Verzweifeln da sei.
Denken Sie, daß ich sehr zufrieden bin, die Parsifal-Musik nicht hören zu müssen. Abgesehen von 2 Stücken (denselben welche auch Sie mir hervorheben) mag ich diesen „Stil“ (dieses mühselige und beladene Stückchen-Werk) nicht: das ist Hegelei in Musik: und überdies ebenso sehr ein Beweis großer Armut an Erfindung als ein Beweis ungeheurer Prätension und Cagliostricität ihres Urhebers. Pardon! In diesem Punkte rigoros. — In Moral bin ich unerbittlich.
265. An Elisabeth Nietzsche in Schulpforte (Postkarte)
Meine liebe Schwester, die Merseburger 5 Damen kommen nicht, und Pfarrer’s halten nun daran fest, daß es bei der ersten Verabredung bleibt. Ich habe es mir noch einmal überlegt und finde es so auch am angenehmsten (außer für Dich, mit dem Schlaf-Kämmerchen da oben!) Also: wenn Du schon geschrieben haben solltest, so schreibe doch umgehend noch eine Karte an Pfarrer’s und sage, daß es bei der ersten Verabredung bleibe. — Man ist sehr artig gegen mich: in summa entstehen 5 neue Bänke in meiner Gegend, und die schönste um eine Buche herum, ganz für meine Bedürfnisse in großer Einsamkeit, soll heißen „die fröhliche Wissenschaft“.
Von Herzen Dein Bruder.
266. An Elisabeth Nietzsche in Schulpforte (Postkarte)
Eben war der Pfarrer da. Es steht ganz so, wie ich Dir schrieb: man wünscht sehr, daß es bei der ersten Verabredung bleibt (also 12 Mark für die drei Räume) Für den Fall, daß Du allein die beiden oberen Zimmer haben willst, verlangt man 8 Mark. Bleiben wir nur bei dem ersten Plane; das Oberstübchen soll sehr verschönert sein, und die Dame, welche jetzt drin wohnt, vollkommen zufrieden sich darüber äußern. Heute Abend wird die schöne Bank gebaut. — (Er hatte schon Deinen Brief.) Ich habe keine Nachrichten von Rées. Sollte wieder die Post — ?
Ich schrieb an Frl. von Meysenbug nach Paris.
Große Verzögerung in Leipzig bei Teubners.
Elend!
Herzliche Grüße.
267. An Erwin Rohde in Tübingen
Mein lieber alter Freund, es hilft nichts, ich muß Dich heute auf ein neues Buch von mir vorbereiten; höchstens noch 4 Wochen hast Du davor Ruhe! Ein mildernder Umstand ist, daß es das letzte für eine lange Reihe von Jahren sein soll: — denn im Herbst gehe ich an die Universität Wien und fange neue Studentenjahre an, nachdem die alten mir, durch eine zu einseitige Beschäftigung mit Philologie, etwas mißrathen sind. Jetzt giebt es einen eigenen Studienplan und hinter ihm ein eigenes geheimes Ziel, dem mein weiteres Leben geweiht ist — es ist mir zu schwer zu leben, wenn ich es nicht im größten Stile thue, im Vertrauen gesagt, mein alter Kamerad! Ohne ein Ziel, welches ich nicht für unaussprechlich wichtig hielte, würde ich mich nicht oben im Lichte und über den schwarzen Fluthen gehalten haben! Dies ist eigentlich meine einzige Entschuldigung für diese Art von Litteratur, wie ich sie seit 1876 mache: es ist mein Recept und meine selbstgebraute Arzenei gegen den Lebens-Überdruß. Welche Jahre! Welche langwierigen Schmerzen! Welche innerlichen Störungen, Umwälzungen, Vereinsamungen! Wer hat denn so viel ausgestanden als ich? Leopardi gewiß nicht! Und wenn ich nun heute über dem Allen stehe, mit dem Frohmuthe eines Siegers und beladen mit schweren neuen Plänen — und, wie ich mich kenne, mit der Aussicht auf neue schwerere und noch innerlichere Leiden und Tragödien und mit dem Muthe dazu! so soll mir niemand darüber böse sein dürfen, wenn ich gut von meiner Arzenei denke. Mihi ipsi scripsi — dabei bleibt es; und so soll Jeder nach seiner Art für sich sein Bestes thun — das ist meine Moral: — die einzige, die mir noch übrig geblieben ist. Wenn selbst meine leibliche Gesundheit zum Vorschein kommt, wem verdanke ich denn das? Ich war in allen Punkten mein eigener Arzt; und als einer, der nichts Getrenntes hat, habe ich Seele Geist und Leib auf Ein Mal und mit denselben Mitteln behandeln müssen. Zugegeben, daß Andere an meinen Mitteln zu Grunde gehen könnten: dafür thue ich auch nichts eifriger als vor mir zu warnen. Namentlich dieses letzte Buch, welches den Titel führt „die fröhliche Wissenschaft“ wird Viele vor mir zurückschrecken, auch Dich vielleicht, lieber alter Freund Rohde! Es ist ein Bild von mir darin; und ich weiß bestimmt, daß es nicht das Bild ist, welches Du von mir im Herzen trägst.
Also: habe Geduld, und sei es auch nur darum, weil Du einsehen mußt, daß es bei mir heißt „aut mori aut ita vivere“.
Von ganzem Herzen
Dein
Nietzsche.
268. An Elisabeth Nietzsche in Naumburg
Meine liebe Schwester,
Heute bin ich krank.—
Rée bildet sich ein, die erste Bayreuther Aufführung sei am 24ten; und ich sehe, daß auch der Reiseplan Lou’s darauf hin eingerichtet ist. Bitte schreibe doch umgehend an L<ou> wie es damit steht. Sie braucht erst am 25ten Abends dort einzutreffen, kann also von Stibbe später abreisen. —
Mein letzter Brief an sie ist gewiß verloren gegangen! (ich schrieb ihr gerade vor 14 Tagen). — äußerst unangenehm!
Die drei Bänke sind fertig. — Vielleicht ergeht es Dir mit L<ou> wie mir mit Tautenburg. — Was ich Dir bisher verschwieg, ist, daß ich für ihre Gesundheit mehr Besorgniß habe, als für die meine. — —
Was das Geld betrifft und den mir von Dir zugedachten Halb-Antheil, so mache ich mir ein Vergnügen daraus, Dich zu bitten, diesen bewußten Halb-Antheil Dir von mir schenken zu lassen (so daß Du nunmehr für die Tautenburger Zwecke 100 M. hast)
Adieu, mein liebes Lama, es muß noch Alles gut werden.
F N.
269. An Lou von Salomé in Stibbe
Nun, meine liebe Freundin, bis jetzt steht Alles gut, und Sonnabend über 8 Tage sehen wir uns wieder.
Vielleicht ist mein letzter Brief an Sie nicht in Ihre Hände gelangt? Ich schrieb ihn Sonntag vor 14 Tagen. Es sollte mir Leid thun; ich schilderte Ihnen darin einen sehr glücklichen Moment: mehrere gute Dinge kamen auf Einmal zu mir, und das „gutste“ dieser Dinge war Ihr Zusagebrief! —
Indessen: wenn man gutes Zutrauen zu einander hat, so dürfen sogar die Briefe verloren gehen.
Ich habe viel an Sie gedacht und im Geiste so mancherlei des Erhebenden, Rührenden und Heiteren mit Ihnen getheilt, daß ich wie mit meiner verehrten Freundin verbunden gelebt habe. Wenn Sie wüßten, wie neu und fremdartig mir alten Einsiedler das vorkommt! — Wie oft habe ich über mich lachen müssen!
Was Bayreuth betrifft, so bin ich zufrieden damit, nicht dort sein zu müssen; und doch, wenn ich ganz geisterhaft in Ihrer Nähe sein könnte, dies und jenes in Ihr Ohr raunend, so sollte mir sogar die Musik zum Parsifal erträglich sein (sonst ist sie mir nicht erträglich.)
Ich möchte, daß Sie vorher noch meine kleine Schrift „Richard Wagner in Bayreuth“ lesen; Freund Rée besitzt sie wohl. Ich habe so viel in Bezug auf diesen Mann und seine Kunst erlebt — es war eine ganze lange Passion: ich finde kein anderes Wort dafür. Die hier geforderte Entsagung, das hier endlich nöthig werdende Mich-selber-Wiederfinden gehört zu dem Härtesten und Melancholischsten in meinem Schicksale. Die letzten geschriebenen Worte W<agner>’s an mich stehen in einem schönen Widmungs-Exemplare des Parsifal „Meinem theuren Freunde Friedrich Nietzsche. Richard Wagner, Ober-Kirchenrath.“ Genau zu gleicher Zeit traf, von mir gesendet, bei ihm mein Buch „Menschliches Allzumenschliches“ ein — und damit war Alles klar, aber auch Alles zu Ende.
Wie oft habe ich, in allen möglichen Dingen, gerade dies erlebt: „Alles klar, aber auch Alles zu Ende“!
Und wie glücklich bin ich, meine geliebte Freundin Lou, jetzt in Bezug auf uns Beide denken zu dürfen „Alles im Anfang und doch Alles klar!“ Vertrauen Sie mir! Vertrauen wir uns!
Mit den herzlichsten Wünschen für Ihre Reise
Ihr Freund
Nietzsche.
270. An Franz Overbeck in Basel (Postkarte)
Mein lieber Freund, herzlichsten Dank für Deine und Eure Bemühungen. Noch habe ich keine Antwort von L<ou>. — Verfüge zu Gunsten des Zahnarztes so wie Du schreibst. — Falls Du die 500 frcs noch nicht in deutsches Geld gewechselt hast, so nimm doch 20 frcs Stücke in Gold. — Ich hätte gern die Adresse von Frl. Helene Truschkowitz und ebenso die von dem Redakteur Curti. — Die Drucksache geht langsam, ich bin beim 8ten Bogen. — Gesundheit befriedigend, doch mit Zwischenfällen. — Euer dankbar ergebener
F.N.
271. An Franziska Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Schönsten Dank meine liebe Mutter! Also: Sonntag will ich kommen, und Abends geht es zurück!
Gestern wieder der Kopfschmerz. —
Ich möchte die beiden Täfelchen Sonntags mitnehmen! Es bleibt bei den Namen. — Nichts was verrostet! —
In herzlicher Liebe Dein und Euer
F.
(Immer „Thüringen“ auf jede Adresse an mich!)
272. An Heinrich Köselitz in Venedig
Mein lieber Freund,
so soll ich denn auch meine Sommer-Musik haben! — auf diesen Sommer strömen die guten Dinge herab, wie als ob ich einen Sieg zu feiern hätte. Und in der That: erwägen Sie, wie ich seit 1876 in mancherlei Betracht, des Leibes und der Seele, ein Schlachtfeld mehr als ein Mensch gewesen bin! —
Lou wird der Klavierpartie nicht gewachsen sein: aber da stellt sich, wie vom Himmel geschickt, im rechten Augenblick Hr. Aegidi ein, ein ernster vertrauenswürdiger Mensch und Musiker, der gerade hier in Tautenburg weilt (ein Schüler Kiel’s) — durch einen Zufall komme ich ein halbes Stündchen mit ihm in Berührung, und wieder ein Zufall war es, daß er, von dieser Begegnung nach Hause kommend, den Brief eines Freundes vorfindet, der so beginnt: „Ich habe soeben einen famosen Philosophen entdeckt, Nietzsche“. —
Sie bleiben natürlich der Gegenstand der äußersten Discretion; eingeführt als italiänischer Freund, dessen Name ein Geheimniß ist. —
Ihre melancholischen Worte „immer daran vorbei“ sind mir sehr im Herzen hängen geblieben! Es gab Zeiten, wo ich ganz dasselbe von mir dachte; aber es giebt zwischen Ihnen und mir außer anderen Unterschieden auch den, daß ich mich mehr zu etwas „schubsen“ lasse (wie man in Thüringen sagt.) —
Sonntags war ich in Naumburg, um meine Schwester ein wenig noch auf den Parsifal vorzubereiten. Da gieng es mir seltsam genug! Schließlich sagte ich: „meine liebe Schwester, ganz diese Art Musik habe ich als Knabe gemacht, damals <als> ich mein Oratorium machte“ — und nun habe ich die alten Papiere hervorgeholt und, nach langer Zwischenzeit, wieder abgespielt: die Identität von Stimmung und Ausdruck war märchenhaft! Ja, einige Stellen zb. „der Tod der Könige“ schienen uns Beiden ergreifender als alles, was wir uns aus dem P<arsifal> vorgeführt hatten, aber doch ganz parsifalesk! Ich gestehe: mit einem wahren Schrecken bin ich mir wieder bewußt geworden, wie nahe ich eigentlich mit W<agner> verwandt bin. — Später will ich Ihnen dieses curiose Faktum nicht vorenthalten, und Sie sollen die letzte Instanz darüber sein — die Sache ist so seltsam, daß ich mir nicht recht traue. —
— Sie verstehen mich wohl, lieber Freund, daß ich damit den Parsifal nicht gelobt haben will!! — Welche plötzliche decadence! Und welcher Cagliostricismus! —
Eine Bemerkung Ihres Briefes giebt mir Anlaß, festzustellen, daß alles, was Sie jetzt von meinen Reimereien kennen, vor meiner Bekanntschaft mit L<ou> entstanden ist (wie auch die „fr<öhliche> Wissenschaft“.) Aber vielleicht haben Sie auch ein Gefühl davon, daß ich, sowohl als „Denker“ wie als „Dichter“, eine gewisse Vorahnung von L<ou> gehabt haben muß? Oder sollte „der Zufall?“ Ja! Der liebe Zufall!
Die comédie soll von uns zusammen gelesen werden; meine Augen sind jetzt allzusehr schon occupirt. L<ou> kommt am Sonnabend. Senden Sie Ihr Werk schnellstens ab — ich beneide mich selber um diese Auszeichnung, die Sie mir erweisen!
Ganz von Herzen Ihr dankbarer Freund Nietzsche.
273. An Elisabeth Nietzsche in Bayreuth (Postkarte)
Meine liebe Schwester, ich habe Deine Adresse nicht! — Sonst ist Alles eingetroffen, die Maschine (prächtig!) und Deine Karte. Ich glaube es wohl, daß es Euch zusammen gut zu Muthe ist! — Besucht doch Overbecks am 30ten, Erlangerstrasse 511 bei Wittwe Köhler. — Fünf Stunden nach Eurem Zusammentreffen in Leipzig hatte ich schon den Brief von L<ou>. — Schreibe genau über die Zeit der Ankunft.
Erwäge ja, daß wenn man nicht ein Paar hohe Augenblicke und Empfindungen von Bayreuth mitnimmt, es keinen Sinn hatte, nach B<ayreuth> zu gehen. —
Dir und Fräulein L<ou> das Herzlichste! Und durch Euch auch an Alle, die mich lieben!
F. N.
274. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz (Postkarte)
Denken Sie sich doch eine Farbe für den Umschlag aus, werthester Herr Schmeitzner, welche nicht so gemein und alltäglich ist und irgend einen Sinn in Bezug auf dies Buch hat. Z.B. ein schönes Grau-Rosa. —
Teubner sandte gestern den 13t Bogen. Es werden 15—16 im Ganzen. Den Text für die zwischen uns besprochne Bemerkung auf der Rückseite des Umschlags habe ich schon festgestellt. Die ersten drei fertigen Exemplare bitte sofort hierher! —
Mit den herzlichsten Wünschen, auch für die Bayreuther Festtage
Ihr
F.N.
275. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Die Septuaginta ist die griechische Übersetzung des alten Testaments. Darin kommen ja unzählig oft die „Heiden“ vor („warum toben die Heiden usw.“); Da steht immer griechisch ἔθνη („Völker“) — und Ulfilas übersetzt dies „Völker“ wörtlich in thiut[e], (ich weiß die richtige Endung nicht mehr). Nämlich „thiuta“ bedeutete damals „Volk“ (die Frage der Etymologie des Wortes ist davon ganz unabhängig!) Ich behaupte: die Gothen haben sich daran gewöhnt, bei ihrem Worte für Völker den Sinn „Heiden“ zu empfinden: wie die griechisch redenden Christen bei ihrem ἔθνη.— Ist mein Brief über das matrim<onio> segr<eto> angekommen? Letzteres sehr erwartet!
Von Herzen
F. N.
Hoch lebe Cagliostro!
276. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Freund! Da Hr. Aegidi schon am 7ten abreist, so werde ich wohl auf Ihr Werk für jetzt verzichten müssen!! Aber bitte, bitte, empfehlen Sie mich dieser Wiener Dame, damit ich in Wien Sie hören kann: ich bin in der äußersten Begierde nach unserer Musik — Pardon für diese Unbescheidenheit! Aber ich dachte an Bayreuth! Der alte Zauberer hat wieder einen ungeheuren Erfolg, mit Schluchzen alter Männer usw. — Cosima, die immer noch „eine treue Zuneigung zu mir“ hat, hat Lou und meine Schwester zu sich privatissime eingeladen — mehr weiß ich noch nicht.
Meine Schwester schrieb: „ich fürchte, ein Tauber wäre von der Aufführung begeistert.“
Beide Damen kommen heute Abend, Wetter dort und hier unsäglich schauderhaft.
Ihr alter Freund
F.N.
W<agner> hat neulich furchtbar traurig gesprochen: „seine besten Freunde Nietzsche, Rohde verließen ihn; er sei einsam“
277. An Jacob Burckhardt in Basel
Nun, mein hochverehrter Freund — oder wie soll ich Sie nennen? — empfangen Sie mit Wohlwollen das, was ich Ihnen heute sende, mit einem vorgefaßten Wohlwollen: denn, wenn Sie das nicht thun, so werden Sie bei diesem Buche „die fröhliche Wissenschaft“ nur zu spotten haben (es ist gar zu persönlich, und alles Persönliche ist eigentlich komisch).
Im Übrigen habe ich den Punkt erreicht, wo ich lebe wie ich denke, und vielleicht lernte ich auch inzwischen wirklich ausdrücken, was ich denke. In Hinsicht hierauf höre ich Ihr Unheil als einen Richterspruch: ich wünschte namentlich, daß Sie den Sanctus Januarius (Buch IV) im Zusammenhang lesen möchten, um zu wissen, ob er als Ganzes sich mittheilt. — Und meine Verse? - - -
In herzlichem Vertrauen
Ihr
Friedrich Nietzsche.
NB. Und was ist doch die Adresse jenes Herrn Curti, von dem Sie mir bei unserm letzten, sehr schönen Zusammensein sprachen?
278. An Heinrich Köselitz in Venedig
Lieber Freund.
Eines Tages flog ein Vogel an mir vorüber; und ich, abergläubisch wie alle einsamen Menschen, die an einer Wende ihrer Straße stehen, glaubte einen Adler gesehn zu haben. Nun bemüht sich alle Welt darum, mir zu beweisen, daß ich mich irre, — und es giebt einen artigen europäischen Klatsch darüber. Wer ist nun der Glücklichere —ich, „der Getäuschte“, wie man sagt, der einen ganzen Sommer ob dieses Vogelzeichens in einer höheren Welt der Hoffnung lebte — oder jene, welche „nicht zu täuschen“ sind? — Und so weiter. Amen.
Gestern, alter Freund, überfiel mich der Dämon der Musik — „stellen Sie sich mein Entsetzen für!“ mit Lessing zu reden. Mein gegenwärtiger Zustand „in media vita“ will auch noch in Tönen sich aussprechen: ich werde nicht loskommen.
Und es ist recht so: bevor ich meine neue Straße ziehe, muß ich noch ein wenig blasen und geigen.
Wien ist vom Horizonte fast verschwunden. Vielleicht München — dabei erwäge ich auch meine Beziehungen zu Levi.
Ich wollte doch, Sie wären in Bayreuth gewesen: man rühmt W<agner>s Instrumentation des Parsifal als das Erstaunlichste in dieser Kunst.
Wann giebt es für mich Ihre Musik! — Jetzt bin ich „ein wenig in der „Wüste“ und schlafe manche Nacht nicht. Aber nichts von Kleinmuth! Und jener erwähnte Dämon war, wie Alles, was mir jetzt über den Weg läuft (oder zu laufen scheint) heroisch-idyllisch.
Adieu, lieber Freund!
Von Herzen
F. N.
279. An Lou von Salomé in Bayreuth (Fragment)
[+ + +] und wie schwer selbst die Pflicht eines Freundes geworden ist, der jetzt noch zu mir tritt. —
Ich wollte allein leben. —
Aber da flog der liebe Vogel Lou über den Weg, und ich meinte, es sei ein Adler. Und nun wollte ich den Adler um mich haben.
Kommen Sie ja, ich bin zu leidend, Sie leidend gemacht zu haben. Wir ertragen es miteinander besser.
F.N.
280. An Franziska Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Unsre letzte Zusammenkunft, meine liebe Mutter, lief etwas melancholisch ab; ob ich schon mit dem entgegengesetzten Wunsche gekommen war: mich bei Dir ein wenig zu erholen, da ich mich sehr angegriffen fühlte. — Daß die Täfelchen immer noch nicht da sind, ist ein Jammer: schließlich kommen sie, wenn alle Gäste fort und Herbststürme vor der Thür sind. Wenigstens hier hat man den Glauben an November: so kalt und trübe ist es. — Bei Gelzers in Jena hatte ich den angenehmsten Nachmittag. Von Herzen Dein F.
281. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Nun, alter lieber Freund, so haben Sie wieder die grausame Quälerei der Correktur überstanden, ich gratulire Ihnen und mir dazu — hoffentlich sind Sie mir trotzdem nicht böse geworden! Ungefähr den 4ten Theil des ursprünglichen Materials habe ich mir vorbehalten (zu einer wissenschaftlichen Abhandlung).
Inzwischen gab es mancherlei Bewegung: in summa läuft Alles „zu meinem Besten“ ab, ich habe eine starke Probe zu bestehen gehabt, und sie bestanden. — L<ou> bleibt noch 14 Tage bei mir: im Herbst treffen wir uns wieder (in München?) Ich habe meinen Blick für Menschen; was ich sehe, existirt auch, wenn es Andre nicht sehen. L<ou> und ich sind sich allzusehr ähnlich, „blutsverwandt“ (ich darf sie also Ihnen nicht einmal mehr loben!)
Von Herzen
282. An Heinrich Köselitz in Venedig
Mein lieber Freund,
die „fröhliche Wissenschaft“ ist eingetroffen; ich sende Ihnen sofort das erste Exemplar. Mancherlei wird Ihnen neu sein: ich habe noch bei der letzten Correktur dies und jenes anders und Einiges hoffentlich besser gemacht. Lesen Sie zb. die Schlüsse des 2ten und 3ten Buchs; auch über Schopenhauer habe ich ausdrücklicher geredet (auf ihn und auf Wagner werde ich vielleicht nie wieder zurückkommen, ich mußte jetzt mein Verhältniß feststellen, in Bezug auf meine früheren Meinungen — denn zuletzt bin ich ein Lehrer und habe die Pflicht, zu sagen, worin ich mir gleich bleibe und worin ich ein Andrer geworden bin) Machen Sie einige Bemerkungen zu diesem und jenem Abschnitt, lieber Freund. Und auch über das Ganze und die ganze Stimmung: theilt sie sich wirklich mit? Namentlich: ist Sanctus Januarius überhaupt verständlich? Nach Allem, was ich erlebt habe, seit ich wieder unter Menschen bin, ist mein Zweifel daran ungeheuer! Ich habe diesen Grad von Fremdheit und Gleichgültigkeit gegen das, was mir das Wichtigste ist, eingerechnet mich selber — nicht für möglich gehalten: darin sind sich alle „Freunde“ gleich. Wer ist mir liebevoller gesinnt als die gute Meysenbug? — aber doch schreibt sie mir eben, sie sei überzeugt, wenn ich „meinen Gipfel erreicht hätte, würde ich freudig wieder zu Wagner und Schopenhauer zurückkehren“. Und Schmeitzner drückt sich in Bezug auf „Zarathustra“ also aus „Nach der letzten Nummer Ihres neuesten Buches zu urtheilen, darf sich der Buchhändler nun freuen, wieder Bücher „für das Publikum“ von Ihnen zu erhalten; das wird auch mehr Leben in den Absatz der älteren bringen.“
Ekel und Mitleid - - -!
Doch, wie gesagt, das sind nicht Ausnahmen, es ist die Regel. Ich habe dies Faktum sogar auf die grausamste aller denkbaren Weisen zu fühlen bekommen — aber das ist Nichts zum Schreiben, und nicht einmal zum Sprechen.
Zuletzt, lieber Freund, bin ich alledem gewachsen, und mein Muth hat bei diesem Aufenthalt unter Gespenstern nicht abgenommen. — Seltsam! In allem bin ich sonst der empfindlichste Mensch: aber was die Meinung über mich betrifft, komme ich mir jetzt so eselhaft-geduldig vor! Wie geht das zu? —
Leben Sie wohl! Wir wollen dem Leben ja nicht gram werden, sondern immer mehr werden, die wir sind — die „fröhlich-Wissenden.“
L<ou> bleibt noch eine Woche bei mir. Sie ist das intelligenteste aller Weiber. Alle fünf Tage haben wir eine kleine Tragödienscene. — Alles, was ich Ihnen über sie schrieb, ist Unsinn, wahrscheinlich auch das, was ich eben schrieb.
Von ganzem Herzen
Ihnen ergeben und
dankbar
F.N.
283. An Franziska Nietzsche in Naumburg (Postkarte).
Einstweilen den herzlichsten Dank, meine liebe Mutter. Die Reine-claudes sind ausgezeichnet, es mögen Jahrzehnde her sein, daß ich keine aß.
Nächsten Sonntag kommen wir nach Naumburg zurück und verlassen Tautenburg.
Näheres schreiben wir noch.
Dein F.
284. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz
Geehrtester Herr Verleger,
nächst dem Danke für Ihren Brief habe ich heute meine Wünsche in Betreff der Freiexemplare und deren Versendung auszusprechen. Von Teubner bekam ich 4 geschickt: davon habe ich bereits 3 verschenkt. Auf alle die Exemplare, welche durch Ihre Gefälligkeit versendet werden, bitte ich nur diese Worte zu setzen:
Absender Professor Nietzsche
Naumburg a/Saale
Baron Gersdorff auf Ostrichen bei Seidenberg (Schlesien)
Der Universitäts-Bibliothek in Basel
zu Händen des Hr. Bibliothekars Dr. Sieber.
Professor Dr. Jakob Burckhardt in Basel
Professor Dr. Overbeck, z.Z. in Dresden, Sidonienstr. 7. (2 Exemplare)
Frau Marie Baumgartner in Lörrach (Baden) Thumringerstr.
Dr. Paul Rée, Stibbe bei Tütz Westpreussen.
Prof. Dr. Rohde, Universität Tübingen
Dr. Paul Förster, Charlottenburg, Bismarckstr.
Madame M. de Meysenbug per adr. Madame Natalie Herzen 2 Exemplare
Paris, rue d’Assas 76.
Hofrath Prof. Dr. Heinze Leipzig
Dem Dichter Gottfried Keller in Zürich (genügt als Adresse!)
Dr. Heinrich Romundt, Leipzig 6 Nürnbergerstr. 2te Treppe
An Hr. Köselitz habe ich schon gesendet, Hr. Widemann wird Ihre Freundschaft schon bedenken oder bedacht haben. — Adresse von jetzt ab: Naumburg a/Saale. Ganz ergeben Ihr
Dr. Nietzsche
285. An Franz Overbeck in Dresden (Postkarte)
Mein lieber Freund, „die fröhliche Wissenschaft“ ist nach Dresden commandirt und wird bald bei Dir eintreffen. Ein 2tes Exemplar, das ich mitsende, bitte ich Frau Rothpletz nach München zu senden, deren Adresse mir fehlt. — Dies Buch ist in jedem Betracht wider den deutschen Geschmack und die Gegenwart: und ich selber bin es noch mehr. Jede Berührung mit Menschen, seit ich Genua verließ, hat mich darüber belehrt. — Nächsten Sonntag siedle ich nach Naumburg über. — Ich hörte gerne, was Deine Frau über den Sanctus Januarius denkt. Euch von Herzen zugethan —
der Genueser.
Lou und meine Schwester senden die besten Grüße.
286. An Theodor Curti in Zürich
Hochgeehrter Herr,
man hat mir gesagt, daß Sie in einem auszeichnenden Grade mehreren meiner Ansichten Ihre Theilnahme zugewendet hätten; und obwohl ich grundsätzlich mich über alles das, was man „Wirkung“ zu nennen pflegt, in tiefster Unwissenheit erhalte, so möchte ich doch gerne in diesem Falle eine Ausnahme machen — einmal in Hinsicht auf das, was ich von dem Charakter, der Unabhängigkeit und dem Geiste dessen hörte, an den zu schreiben ich die Ehre habe (— Jakob Burckhardt war es, der mir von Ihnen sprach), sodann, weil es mich ganz und gar überrascht, daß meine politisch-sozialen Maienkäfer die ernsthafte Theilnahme eines politisch-sozialen Denkers erregt haben. Es kann kein Mensch in Bezug auf diese Dinge mehr „im Winkel leben“ als ich: ich spreche nie von dergleichen, ich weiß die bekanntesten Ereignisse nicht und lese nicht einmal die Zeitungen — ja ich habe mir aus dem Allem ein Privilegium gemacht! — Und so wäre ich denn gerade in diesem Punkte gar nicht böse, wenn ich mit meinen Ansichten Lachen und Heiterkeit erregt hätte: aber Ernst? Und bei Ihnen? Könnte ich das nicht zu lesen bekommen?
Zufällig höre ich, daß der jüngst verstorbene Bruno Bauer in seinen alten Tagen sich auch dies und jenes aus meinen Gedanken über das bezeichnete Gebiet herausgeholt habe. Ein paar ähnliche Mittheilungen kamen noch hinzu: sodaß ich neugierig über mich selber geworden bin.
Verzeihung, verehrter Herr! Sie sind jetzt das Opfer dieser Neugierde!
Mit ergebenstem Gruß
der Ihrige
Prof.Dr. F. Nietzsche
Adresse: „Tautenburg bei Dornburg“
(Thüringen)
287. An Lou von Salomé in Tautenburg
[+ + +]
Menschen, die nach Größe streben, sind gewöhnlich böse Menschen; es ist ihre einzige Art, sich zu ertragen.
Wer das Große nicht mehr in Gott findet, findet es überhaupt nicht vor und muß es entweder leugnen oder — schaffen (schaffen-helfen).
<3.>
[+ + +]
Die ungeheure Erwartung in Betreff der Geschlechtsliebe verdirbt den Frauen das Auge für alle fernen Perspektiven.
Heroismus — das ist die Gesinnung eines Menschen, der ein Ziel erstrebt, gegen welches gerechnet er gar nicht mehr in Betracht kommt. Heroismus ist der gute Wille zum absoluten Selbst-Untergange.
Der Gegensatz des heroischen Ideals ist das Ideal der harmonischen All-Entwicklung — ein schöner Gegensatz und ein sehr wünschenswerther! Aber nur ein Ideal für grundgute Menschen (Goethe zb.)
Liebe ist für Männer etwas ganz Anderes als für Frauen. Den Meisten wohl ist Liebe eine Art Habsucht; den übrigen Männern ist Liebe die Anbetung einer leidenden und verhüllten Gottheit.
Wenn Freund Rée dies läse, würde er mich für toll halten.
Wie geht es? — Es gab nie einen schöneren Tag in Tautenburg als heute. Die Luft klar, mild, kräftig: so wie wir Alle sein sollten.
Von Herzen
F.N.
288. An Lou von Salomé in Tautenburg
Zur Lehre vom Stil.
Das Erste, was noth thut, ist Leben: der Stil soll leben.
Der Stil soll dir angemessen sein in Hinsicht auf eine ganz bestimmte Person, der du dich mittheilen willst. (Gesetz der doppelten Relation.)
Man muß erst genau wissen: „so und so würde ich dies sprechen und vortragen“ — bevor man schreiben darf. Schreiben muß eine Nachahmung sein.
Weil dem Schreibenden viele Mittel des Vortragenden fehlen, so muß er im Allgemeinen eine sehr ausdrucksvolle Art von Vortrag zum Vorbild haben: das Abbild davon, das Geschriebene, wird schon nothwendig viel blässer ausfallen.
Der Reichthum an Leben verräth sich durch Reichthum an Gebärden. Man muß Alles, Länge und Kürze der Sätze, die Interpunktionen, die Wahl der Worte, die Pausen, die Reihenfolge der Argumente — als Gebärden empfinden lernen.
Vorsicht vor der Periode! Zur Periode haben nur die Menschen ein Recht, die einen langen Athem auch im Sprechen haben. Bei den Meisten ist die Periode eine Affektation.
Der Stil soll beweisen, daß man an seine Gedanken glaubt, und sie nicht nur denkt, sondern empfindet.
Je abstrakter die Wahrheit ist, die man lehren will, um so mehr muß man erst die Sinne zu ihr verführen.
Der Takt des guten Prosaikers in der Wahl seiner Mittel besteht darin, dicht an die Poesie heranzutreten, aber niemals zu ihr überzutreten.
Es ist nicht artig und klug, seinem Leser die leichteren Einwände vorwegzunehmen. Es ist sehr artig und sehr klug, seinem Leser zu überlassen, die letzte Quintessenz unsrer Weisheit selber auszusprechen.
F.N.
Einen guten Morgen,
meine liebe Lou!
289. An Lou von Salomé in Tautenburg <Widmung>
Sommer 1876
Nicht mehr zurück? Und nicht hinan?
Auch für die Gemse keine Bahn?
*
So wart’ ich hier und fasse fest,
Was Aug’ und Hand mich fassen läßt:
*
Fünf Fuß breit Erde, Morgenroth,
Und unter mir — Welt, Mensch und Tod.
*
F.N.
Meiner lieben Lou. — Sommer 1882
290. An Lou von Salomé in Tautenburg (Zettel)
Zu Bett. Heftigster Anfall. Ich verachte das Leben.
FN.
291. An Lou von Salomé in Tautenburg (Zettel)
Meine liebe Lou,
Pardon für gestern! Ein heftiger Anfall meines dummen Kopfleidens — heute vorbei.
Und heute sehe ich Einiges mit neuen Augen. —
Um 12 Uhr bringe ich Sie nach Dornburg: — aber vorher müssen wir noch ein halbes Stündchen sprechen (bald, ich meine, sobald Sie aufgestanden sind.) Ja? —
Ja!
F.N.
292. An Paul Rée in Stibbe
Mein lieber Freund,
ich erinnere mich, einige Male darüber gegrübelt zu haben, daß Sie mir von dem Augenblicke an, wo L<ou> in Stibbe war, keinen Brief mehr schrieben. Nun habe ich es, ganz und gar ohne Absicht der Nachahmung, im gleichen Falle gleich gemacht — und ich bin überzeugt, daß Sie darüber nicht mehr gegrübelt haben. Es läßt sich über L<ou> nicht schreiben, es sei denn „über ihre Begabung“ (und auch dies wäre nur eine Form des Nichtschreibens). Sehen wir zu, ob wir es einmal dazu bringen, über sie zu sprechen! —
Im Übrigen habe ich mich in der ganzen Angelegenheit betragen, wie es meiner Privat-Moral gemäß ist; und da ich dieselbe nicht zum Gesetz für Andere mache, so fehlt mir heute jeder Anlaß zum Loben und Tadeln — ein Grund mehr, keine Briefe zu schreiben! —
Ich habe einige Schritte gethan zum Zweck der baldigen Übersiedelung nach Paris. —
Ist „die fröhliche Wissenschaft“ in ihren Händen, das Persönlichste aller meiner Bücher? In Anbetracht, daß alles sehr Persönliche ganz eigentlich komisch ist, erwarte ich in der That eine „fröhliche“ Wirkung. — Lesen Sie doch den Sanctus Januarius einmal im Zusammenhang! Da steht meine Privat-Moral beisammen, als die Summe meiner Existenz-Bedingungen, welche nur ein Soll vorschreiben, falls ich mich selber will.
Ich lege ein Billet an unsere Lou bei.
Adieu, lieber alter Freund! Und mögen auch Ihnen „alle Erlebnisse nützlich, alle Tage heilig und alle Menschen göttlich sein“ — so wie sie mir es sind.
Mit den herzlichsten Wünschen
Ihr
F Nietzsche.
293. An Lou von Salomé in Stibbe
Meine liebe Lou,
einen Tag später als Sie gieng ich von Tautenburg weg, im Herzen sehr stolz, sehr muthig — wodurch eigentlich?
Mit meiner Schwester habe ich nur wenig noch gesprochen, doch genug, um das neue auftauchende Gespenst in das Nichts zurück zu schicken, aus dem es geboren war.
In Naumburg kam wieder der Dämon der Musik über mich — ich habe Ihr Gebet an das Leben componirt; und meine Pariser Freundin Ott, die im Besitz einer wundervoll starken und ausdrucksreichen Stimme ist, soll es Ihnen und mir einmal vorsingen.
Zuletzt, meine liebe Lou, die alte tiefe herzliche Bitte: werden Sie, die Sie sind! Erst hat man Noth, sich von seinen Ketten zu emancipiren, und schließlich muß man sich noch von dieser Emancipation emancipiren! Es hat Jeder von uns, wenn auch in sehr verschiedener Weise an der Ketten-Krankheit zu laboriren, auch nachdem er die Ketten zerbrochen hat.
Von Herzem Ihrem
Schicksale gewogen — denn
ich liebe auch in Ihnen
meine Hoffnungen.
F.N.
294. An Carl von Gersdorff in Ostrichen
Nun, mein alter Freund, endlich bin auch ich wieder einmal im Stande, Dir etwas zu senden — und zwar ein rechtes Lebens-Zeichen. Jetzt, wo ich in media vita bin, habe ich alle Gründe, dem Leben nicht gram zu sein; und ich wünsche, daß Du, mein Kriegs-Kamerad des Lebens, auch mein Siegs-Kamerad sein möchtest. —
Im Übrigen ist Brief-schreiben Unsinn für mich, das weißt Du ja! Dafür erzählen meine Bücher so viel von mir, als hundert Freundschafts-Briefe nicht könnten. Lies namentlich den Sanctus Januarius in diesem Sinne. —
Nun habe ich alter Genueser und Nachahmer des Columbus Genua verlassen, die mir liebste Stadt der Erde. Wo wirst Du diesen Winter sein, zusammen mit Deiner lieben Frau (der ich meine ergebensten Grüße sende)
Vielleicht in Paris ? — Ich wenigstens werde dort sein.
Einstweilen bleibe ich noch einige Zeit in Naumburg. Gewiß einige Tage.
Von Herzen Dein
Freund Nietzsche.
295. An Heinrich Köselitz in Venedig
Mein lieber, lieber Freund, diesmal kommt „Musik“ zu Ihnen. Ich möchte gern ein Lied gemacht haben, welches auch öffentlich vorgetragen werden könnte —, „um die Menschen zu meiner Philosophie zu verführen“. Urtheilen Sie, ob dies „Gebet an das Leben“ sich dazu schickt. Ein großer Sänger könnte mir damit die Seele aus dem Leibe ziehn; vielleicht aber, daß andre Seelen sich dabei erst recht in ihrem Leib verstecken! — Ist es Ihnen möglich, der Composition als solcher etwas den laienhaften Strich und Griff zu nehmen? Daß ich mir nach meinem Maaßstabe Mühe gegeben habe, werden Sie mir vielleicht glauben, nämlich auf mein Wort hin. Alle Vortragsbezeichnungen bedürfen der Revision und Correctur.
F.N.
Gewiß — so liebt ein Freund den Freund,
wie ich dich liebe, räthselvolles Leben!
Ob ich in dir gejauchzt, geweint,
ob du mir Leid, ob du mir Lust gegeben,
ich liebe dich mit deinem Glück und Harme,
und wenn du mich vernichten mußt,
entreiße ich mich schmerzvoll deinem Arme,
gleich wie der Freund der Freundesbrust.
Mit ganzer Kraft umfass’ ich dich,
laß deine Flamme meinen Geist entzünden
und in der Gluth des Kampfes mich
die Räthsellösung deines Wesens finden!
Jahrtausende zu denken und zu leben,
wirf deinen Inhalt voll hinein, —
Hast du kein Glück mehr übrig mir zu geben,
wohlan — so gieb mir deine Pein.
Ihr Brief, das Zeugniß meines einzigen Lesers, that mir sehr, sehr wohl. —
Was macht die Gesundheit „des Gesunden“?
Ich bleibe einige Tage noch in Naumburg a/Saale.
296. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz
Geehrtester Herr Verleger,
in Anbetracht, daß ich in einigen Tagen von Naumburg abreisen möchte, wäre es mir sehr erwünscht, wenn Sie mir, gemäß der Notiz Ihres letzten Briefes über die Rückkehr Ihres Banquiers im September, das Honorar hierher senden wollten.
Was mein letztes Buch anbetrifft, so verbürge ich Ihnen seine Dauerhaftigkeit inmitten des Wechsels von Geschmacks-Strömungen. Ich schreibe nur, was von mir erlebt worden ist, und verstehe es auszudrücken: dergleichen Bücher bleiben immer „übrig.“ — —
Mein Aufenthalts-Ort wird für die nächsten Jahre Paris sein. —
Ich habe noch kein Zeichen dafür, daß die Freiexemplare in den Händen der Betreffenden-Betroffenen sind. Wahrscheinlich sind sie noch nicht in deren „Köpfen“. —
Mit herzlichen
Wünschen Ihr
Dr. Nietzsche.
297. An Otto Eiser in Frankfurt
Lieber und verehrter Herr Doctor,
nicht wahr, ich darf nicht durch Frankfurt reisen, ohne Sie zu sehen? Ja, am liebsten bliebe ich einen Tag, da es sich nicht nur um’s Sehen, sondern um’s Sprechen handelt. Ob ich aber diesen Tag bei Ihnen im Hause bleiben kann, darüber werden Sie oder Ihre verehrungswürdige Frau Gemahlin mir ein Wort auf ein Postkärtchen schreiben — ein Wort der unbedingtesten Unbefangenheit, wie es nicht nur unter Kranken, sondern namentlich unter Freunden am Platze ist. Ja? — Ich will in einigen Tagen nach Paris übersiedeln und meine Reise über Frankfurt machen; woselbst ich Morgens gegen 8 Uhr eintreffen würde.
In der Hauptsache darf ich mich als Genesenen und mindestens als Genesenden bezeichnen. Seltsam und unglaublich, nicht wahr? Es bleibt übrig, Ihnen Einiges zu erzählen, das vielleicht auch den Arzt interessiren möchte.
Von Herzen der Ihre Dr. Friedrich Nietzsche
zur Zeit in Naumburg a./Saale
298. An Lou von Salomé in Stibbe
Meine liebe Lou,
Alles, was Sie mir melden, thut mir sehr wohl. Übrigens bedarf ich etwas des Wohlthuenden!
Mein Venediger Kunstrichter hat einen Brief über meine Musik zu Ihrem Gedichte geschrieben; ich lege ihn bei — Sie werden Ihre Nebengedanken dabei haben. Es kostet mich immerfort noch den größten Entschluß, das Leben zu acceptiren. Ich habe zu viel vor mir, auf mir, hinter mir. — Heute siedele ich nach Leipzig über, vielleicht sogar, wenn mir Einiges gelingt, auf einen Monat. Ich will die Bibliothek benutzen und arbeiten.
Es kommt mir jetzt so vor, als ob meine Rückkehr „zu den Menschen“ dahin ausschlagen sollte, daß ich die Wenigen, die ich noch in irgend einem Sinne besaß, verliere. Alles ist Schatten und Vergangenheit. Der Himmel erhalte mir mein Bischen Humanität! —
Von Tautenburg vergaß ich zu erzählen, daß der Pfarrer außer sich vor Erstaunen war, als er den Tag nach Ihrer Abreise hörte, eine Schülerin Biedermann’s im Hause gehabt zu haben. Er hält diesen nämlich für den scharfsinnigsten Philosophen und sich selber für den einzigen wahren Schüler desselben. Die 3 Mark, welche Sie in Dornburg auf den Tisch gelegt hatten, habe ich mir erlaubt, in Ihrem Namen dem Tautenburger Verschönerungs-Verein zu übergeben.
Meine Schwester ist nicht zurückgekehrt.
Eben kam das matrimonio segreto an — nach erstem Durchblättern schon mir als Meisterstück erkenntlich. Lachen Sie nicht über die Schnelligkeit meines Unheils — ich bin sehr, sehr Musiker.
Ich empfehle Ihnen und Freund Rée (dem ich herzlich für seinen Brief danke) darüber nachzudenken, wie sich das Verantwortlichkeitsgefühl entwickelt hat. Das Ichgefühl des Einzelnen der Heerde, ebenso wie sein Gewissensbiß als Heerden-Gewissensbiß ist außerordentlich schwer mit der Phantasie zu erfassen — und ganz und gar nicht nur zu erschließen. Die größte Bestätigung meiner Heerden-Instinkt-Theorie gab mir jüngst das Nachdenken über die Entstehung der Sprache.
Vorwärts, meine liebe Lou, und aufwärts!
Mit den herzlichsten Wünschen Ihr F.N.
Adr: Leipzig poste restante.
299. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz (Postkarte)
Werther Herr Verleger, ich siedle heute nach Leipzig über und werde da wahrscheinlich bis Ende <des> Monats bleiben. Meine Adresse zunächst: poste restante. (Dr. Romundt’s Adresse ist „Nürnberger Str. 6, 2 Treppen) Mit der Geldsendung hat es gar keine Eile: wenn ich nur im Verlauf des Monats dazu komme. Sie bezeichnen mir viel. ein Leipziger Haus, wo ich die Summe erheben kann? — Zwei vorzügliche Photographien folgen, besser kann’s ein Maler nicht machen.
Dr.F.N.
300. An Elisabeth Nietzsche in Tautenburg
In zwei, drei Tagen, meine liebe Lisbeth, geht es fort; an Eisers, die ich in Frankfurt aufsuchen will, habe ich geschrieben, und sobald ich von Dir Herrn Sulger’s Adresse weiß, wird alles in Ordnung sein. Gestern erhielt ich zwei Postkarten von Dir — aus Messina über Rom und Basel — Ehre der Post! —
Ich habe auch meine für Naumburg festgesetzte Arbeit (eine Composition) schönstens erledigt und auch dabei mir genug gethan. —
Wenn ich Dir nur einen Begriff von meiner fröhlichen Zuversicht geben könnte, die mich diesen Sommer beseelt hat! Es ist mir Alles gelungen und Manches wider Erwarten — gerade da als ich es mißlungen glaubte. Auch Lou ist sehr zufriedengestellt (sie steckt jetzt ganz in Arbeit und Büchern.) Was mir sehr wesentlich ist: sie hat Rée zu einer meiner Hauptansichten bekehrt (wie er selbst schreibt), die das Fundament seines Buches völlig verändert. Rée schrieb gestern „Lou ist entschieden in Tautenburg um einige Zoll gewachsen“.
Ich höre mit Betrübniß, daß Du noch immer an der Nachwirkung jener Scenen zu leiden hast, die ich Dir von Herzen gern erspart hätte. Halte aber nur diesen Gesichtspunkt fest: durch die Aufregung dieser Scenen kam an’s Licht, was sonst vielleicht lange im Dunklen geblieben wäre: daß L<ou> eine geringere Meinung von mir und einiges Mißtrauen gegen mich hatte; und wenn ich genauer die Umstände unsres Bekanntwerdens erwäge, so hatte sie vielleicht dazu ein gutes Recht (eingerechnet die Wirkung einiger unvorsichtigen Äußerungen von Freund R<ée>) Nun denkt sie aber jetzt ganz gewiß besser von mir — und das ist doch die Hauptsache, nicht wahr, meine liebe Schwester? Im Übrigen, wenn ich an die Zukunft denke, so wäre es mir hart, annehmen zu müssen, daß Du mit mir in Bezug auf L<ou> nicht gleich empfändest. Wir haben eine solche Gleichartigkeit der Gaben und Absichten, daß unsre Namen irgend wann einmal zusammen genannt werden müssen; und jede Verunglimpfung, die sie trifft, wird mich zuerst treffen.
Doch vielleicht ist dies wieder schon zu viel über diesen Punkt. Ich danke Dir nochmals von ganzem Herzen für alles, was Du mir Gutes in diesem Sommer angethan hast — und ich erkenne Dein schwesterliches Wohlwollen wahrhaftig recht sehr in dem auch, wo Du mit mir nicht gleichempfinden konntest. Ja, wer darf sich auch mit mir wider-moralischen Philosophen ohne Gefahr einlassen! Zweierlei verbietet mir meine Denkweise unbedingt: 1) Reue 2) moralische Entrüstung. —
Sei wieder gut, liebes Lama!
Dein Bruder.
301. An Franz Overbeck in Basel
Mein lieber Freund, so sitze ich denn einmal wieder in Leipzig, der alten Bücher-Stadt, um einige Bücher kennen zu lernen, bevor es wieder in die Ferne geht. Mit dem deutschen Winter-Feldzug wird es wohl nichts werden: ich bedarf in jedem Sinne des hellen Wetters. Ja Charakter hat er, dieser Wolken-Himmel Deutschlands, ungefähr, wie mich dünkt, wie die Parsival-Musik Charakter hat — aber einen schlechten. Vor mir liegt der erste Akt des matrimonio segreto — goldene, glitzernde, gute, sehr gute Musik!
Die Tautenburger Wochen haben mir wohlgethan, namentlich die letzten; und im Ganzen Großen habe ich ein Recht, von Genesung zu reden, wenn ich auch häufig genug an das labile Gleichgewicht meiner Gesundheit erinnert werde. Aber reinen Himmel über mir! Sonst verliere ich allzu viel Zeit und Kraft!
Wenn Du den Sanctus Januarius gelesen hast, so wirst Du gemerkt haben, daß ich einen Wendekreis überschritten habe. Alles liegt neu vor mir, und es wird nicht lange dauern, daß ich auch das furchtbare Angesicht meiner ferneren Lebens-Aufgabe zu sehen bekomme. Dieser lange reiche Sommer war für mich eine Probe-Zeit; ich nahm äußerst muthig und stolz von ihm Abschied, denn ich empfand für diese Zeitspanne wenigstens die sonst so häßliche Kluft zwischen Wollen und Vollbringen als überbrückt. Es gab harte Ansprüche an meine Menschlichkeit, und ich bin mir im Schwersten genug geworden. Diesen ganzen Zwischenzustand zwischen sonst und einstmals nenne ich „in media vita“; und der Dämon der Musik, der mich nach langen Jahren wieder einmal heimsuchte, hat mich gezwungen, auch in Tönen davon zu reden.
Das Nützlichste aber, was ich diesen Sommer gethan habe, waren meine Gespräche mit Lou. Unsre Intelligenzen und Geschmäcker sind im Tiefsten verwandt — und es giebt andererseits der Gegensätze so viele, daß wir für einander die lehrreichsten Beobachtungs-Objekte und -Subjekte sind. Ich habe noch Niemanden kennen gelernt, der seinen Erfahrungen eine solche Menge objektiver Einsichten zu entnehmen wüßte, Niemanden, der aus allem Gelernten so viel zu ziehn verstünde. Gestern schrieb mir Rée „Lou ist entschieden um einige Zoll gewachsen in Tautenburg“ — nun, ich bin es vielleicht auch. Ich möchte wissen, ob eine solche philosophische Offenheit, wie sie zwischen uns besteht, schon einmal bestanden hat. L<ou> ist jetzt ganz in Büchern und Arbeiten versteckt; ihr größter Dienst, den sie mir bisher erwiesen, ist der, Rée zu einer Reform seines Buches auf Grund eines meiner Hauptgedanken bestimmt zu haben. — Ihre Gesundheit reicht nur für 6—7 Jahre aus, wie ich fürchte.
Tautenburg hat Lou ein Ziel gegeben. — Sie hinterließ mir ein ergreifendes Gedicht „Gebet an das Leben“.
Leider hat sich meine Schwester zu einer Todfeindin L<ou>’s entwickelt, sie war voller moralischer Entrüstung von Anfang bis Ende und behauptet nun zu wissen, was an meiner Philosophie ist. Sie hat an meine Mutter geschrieben, „sie habe in Tautenb. meine Philosophie in’s Leben treten sehen und sei erschrocken: ich liebe das Böse, sie aber liebe das Gute. Wenn sie eine gute Katholikin wäre, so würde sie in’s Kloster gehen und für all das Unheil büßen, was daraus entstehen werde.“ Kurz, ich habe die Naumburger „Tugend“ gegen mich, es giebt einen wirklichen Bruch zwischen uns — und auch meine Mutter vergaß sich einmal so weit mit einem Worte, daß ich meine Koffer packen ließ und morgens früh nach Leipzig fuhr. Meine Schwester (die nicht nach Naumb. kommen wollte, so lange ich dort war und noch in Tautenburg ist) citirt dazu ironisch „Also begann Zarathustra’s Untergang“. — In der That, es ist der Beginn vom Anfang. — Dieser Brief ist für Dich und Deine liebe Frau, haltet mich nicht für menschenfeindlich. Ganz von Herzen
Dein F.N.
Das Herzlichste an Frau Rothpletz und die Ihrigen!
Ich dankte Dir noch nicht für Deinen herzlichen Brief.
302. An Franziska Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Meine liebe Mutter, Kopfschmerz-Anfall und 2 schlaflose Nächte bisher, ebenfalls augenleidend. Aber wenigstens untergebracht, mit großer Anstrengung und Sucherei! Romundt verreist; ich war eine Nacht in seiner Wohnung. Adresse also für den Schmeitznerschen Brief:
Leipzig, Auenstrasse, 26, 2te Etage bei
Lehrer Janicaud.
In der Nähe des Rosenthals. Die innere Stadt macht mich bisher fast ohnmächtig.
Dein F.
Sonst poste restante.
Ganz studentisch, 15 M. monatlich. Ruhig.
303. An Paul Rée in Stibbe
Mein lieber Freund,
ich bin der Meinung, daß wir Beide und wir Drei klug genug sind, um uns gut zu sein und zu bleiben. In diesem Leben, wo Menschen wie wir so leicht zu Gespenstern werden, vor denen man sich fürchtet, wollen wir uns an einander freuen und uns Freude zu machen suchen; und wollen darin erfindsam werden — ich für meinen Theil muß darin sehr nachlernen, da ich ein isolirtes Ungeheuer war.
Meine Schwester hat inzwischen die Feindseligkeit ihrer Natur, die sie gewöhnlich gegen ihre Mutter ausläßt, mit aller Kraft gegen mich gekehrt und sich förmlich von mir gelöst, in einem Briefe an meine Mutter, aus Abscheu vor meiner Philosophie, und „weil ich das Böse liebe, sie aber das Gute“ und dergleichen Tollheit. Mich selber hat sie mit Spott und Hohn überschüttet — nun, die Wahrheit ist, ich bin gegen sie mein Leben lang geduldig und milde gewesen, wie ich es nun einmal gegen dies Geschlecht sein muß: und das hat sie vielleicht verwöhnt. „Auch die Tugenden werden bestraft“ — sagte der weise Sanctus Januarius von Genua.
Morgen schreibe ich an unsre liebe Lou, meine Schwester (nachdem ich die natürliche Schwester verloren habe, muß mir schon eine übernatürliche Schwester geschenkt werden.) Und Anfangs Oktober auf Wiedersehen in Leipzig! Ihr
Freund F.N.
Auenstr. 26, 2 Etage.
304. An Jenny Rée in Stibbe
Hochverehrte Frau,
sehen Sie dies Bild an und erschrecken Sie nicht: das bin ich. Schon lange suchte ich nach einer Gelegenheit, Ihnen ein Zeichen davon zu geben, wie vielfach verbunden und dankbar ich mich gegen Sie fühle — seit manchem Jahre schon und neuerdings immer mehr. Heute sendet der Photograph die Bilder; und das erste soll die Ehre haben, an Sie verehrteste Frau, abgehen zu dürfen. Ihr Sohn Paul und <ich,> wir sind nun eine gute Strecke Zeit <einander> lieb geblieben, und jetzt, wo unsre Freundschaft zu einer Art Dreieinigkeit geworden ist, haben wir einen Grund mehr, einander gute Freunde zu bleiben, um unsrer lieben Dritten im Bunde das Leben etwas erträglicher und ihrer Natur würdiger zu gestalten. Alles Vertrauen, was Sie uns hierin bezeigen, ist Etwas, vor dem ich einen hohen Respekt empfinde —: ich danke Ihnen von ganzem Herzen dafür.
Ihr
Dr F. Nietzsche.
305. An Lou von Salomé in Stibbe
Meine liebe Lou, Ihr Gedanke einer Reduktion der philosophischen Systeme auf Personal-Acten ihrer Urheber ist recht ein Gedanke aus dem „Geschwistergehirn“: ich selber habe in Basel in diesem Sinne Geschichte der alten Philosophie erzählt und sagte gern meinen Zuhörern: „dies System ist widerlegt und todt — aber die Person dahinter ist unwiderlegbar, die Person ist gar nicht todt zu machen“ — zum Beispiel Plato.
Ich lege heute einen Brief des Professor Jacob Burckhardt bei, den Sie ja einmal kennen lernen wollten. Auch er hat etwas Unwiderlegbares in seiner Persönlichkeit; aber da er ein ganzer eigentlicher Historiker ist (der Erste unter allen lebenden), so hat er gerade daran, an dieser ewig ihm einverleibten Art und Person, kein Genügen, er möchte gar zu gerne einmal aus andern Augen sehen, zum Beispiel, wie der seltsame Brief verräth, aus den meinigen. Übrigens glaubt er an einen baldigen und plötzlichen Tod, durch Schlagfluß, nach Art seiner Familie; vielleicht möchte er mich gerne als Nachfolger in seiner Professur? — Aber über mein Leben ist schon verfügt. —
Inzwischen hat der Prof. Riedel hier, der Präsident des deutschen Musik-Vereins, für meine „heroische Musik“ (ich meine Ihr Lebens-Gebet“); Feuer gefangen — er will es durchaus haben, und es ist nicht unmöglich, daß er es für seinen herrlichen Chor (einen der ersten Deutschlands „der Riedelsche Verein“ genannt) zurecht macht. Das wäre so ein kleines Weglein, auf dem wir Beide zusammen zur Nachwelt gelangten — andre Wege vorbehalten. —
Was Ihre „Charakteristik meiner selber“ betrifft, welche wahr ist, wie Sie schreiben: so fielen mir meine Verschen aus der fröhlichen Wissenschaft ein — p.10, mit der Überschrift „Bitte“. Errathen Sie, meine liebe Lou, um was ich bitte? —Aber Pilatus sagt: „was ist Wahrheit!“ —
Gestern Nachmittag war ich glücklich; der Himmel war blau, die Luft mild und rein, ich war im Rosenthal, wohin mich Carmen-Musik lockte. Da saß ich 3 Stunden, trank den zweiten Cognac dieses Jahres, zur Erinnerung an den ersten (ha! wie häßlich er schmeckte!) und dachte in aller Unschuld und Bosheit darüber nach, ob ich nicht irgend welche Anlage zur Verrücktheit hätte. Ich sagte mir schließlich Nein. Dann begann die Carmen-Musik, und ich gieng für eine halbe Stunde unter in Thränen und Klopfen des Herzens. — Wenn Sie aber dies lesen, werden Sie schließlich sagen: Ja! und eine Note zur „Charakteristik meiner selber“ machen. —
Kommen Sie doch recht, recht bald nach Leipzig! Warum denn erst am 2 Oktober? Adieu, meine liebe Lou!
Ihr F.N.
306. An Gottfried Keller in Zürich
Hochverehrter Mann,
ich wünschte, Sie wüßten schon irgend woher, daß Sie das für mich sind — ein sehr hochverehrter Mann, Mensch und Dichter. So brauchte ich mich heute nicht zu entschuldigen, daß ich Ihnen kürzlich ein Buch zusendete.
Vielleicht thut Ihnen dieses Buch trotz seinem fröhlichen Titel wehe? Und wahrhaftig, wem möchte ich weniger gern wehe thun als gerade Ihnen, dem Herz-Erfreuer! Ich bin gegen Sie so dankbar gesinnt!
Von Herzen der Ihrige
Dr. Friedrich Nietzsche
(ehemals Professor der Universität
Basel und Drei Viertels-Schweizer)
307. An Heinrich Köselitz in Venedig
Endlich, liebster Freund, habe ich Etwas von Ihrer Musik zu hören bekommen; ich mußte, um dies zu ermöglichen, nach Leipzig übersiedeln, und auch hier fand sich nicht gleich der Vermittler. Genug, gestern Nachmittag haben wir, nämlich der alte Riedel (der Präsident des deutschen Musikvereins, der ein Paar Tage lang sich mit dem ganzen Klavierauszuge vertraut zu machen gesucht hatte) und ich, über dieser „Musik für Italiäner“ gehockt, und dies mit einer herzlichen Bewunderung für deren Urheber. (In Bezug auf Sie, — Name, Person, Vergangenheit — war ich natürlich von der äußersten Vorsicht: kaum, daß R<iedel> weiß, daß der Componist ein Deutscher ist.) Es ist Alles so fertig und meisterlich; R<iedel> sagte alle Augenblicke „fein“, „sehr fein“, namentlich im Harmonischen. Was das Melodische betrifft, so war nicht Jegliches nach seinem Geschmack (er ist gerade in ein höchst contrapunktisches Requiem von Dräseke verliebt —)
Ich selber, theurer Freund, bin langsam in der Liebe, haben Sie darin Geduld mit mir! Um Etwas zu nennen, was mir sehr einleuchtete: Ouvertüre zweite Hälfte der zweiten Seite, namentlich von dem legatissimo an. — Ihr Stil hat an symphonischer Breite gewonnen, und zwar im tempo allegro und vor allem in der allegria selber: worin jetzt die Besten keinen Athem haben. — Ihr Recitativ ist voller Musik, und weder trocken, noch besoffen — eine gewisse italiänische Abneigung gegen die deutsche Gefühls-Trunksucht fällt mir überhaupt auf. — Zuletzt möchte ich doch glauben, diese Musik sei italiänische Musik für Deutsche, sogar für Wagnerianer. Man genießt dabei das Glück der zweiten Unschuld.
Nichts wäre leichter als hier in diesem Winter Ihr „Sch<erz>, L<ist> und R<ache>“ zur Aufführung zu bringen. Der Unternehmer, der ehemals berühmte Stägemann, sucht nach einer Novität und findet nichts, der Kapellmeister Hr. Nikisch wird mir von allen Seiten gepriesen als großer Dirigent, als feinsinniger und neuerungslustiger Musiker, der für Ihr Werk mit Passion thätig sein würde. Es ist ein Augenblick, wo die Küche heiß ist, man brauchte die Schüssel nur hineinzuschieben. Aber ich weiß gar nichts vom Schicksale und Aufenthalte Ihres Werkes. Auch ich, beiläufig gesagt, wurde beim Anhören Ihrer Musik, etwas begehrlich nach der italiänischen „Sentimentalität“. In Messina, wo ich die Luft Bellini’s athmete (Catania ist sein Geburtsort) verstand ich, daß ohne jene 3, 4 Thränen man die Heiterkeit nicht lange aushält (Meine Idyllen aus Messina sind nach diesem Recepte componirt.)
Auch der Musikverleger Fritzsch ist von ganzem Herzen bereit, einer Leipziger Aufführung eines Ihrer Werke sich zu widmen; Nikisch ist eng mit ihm befreundet. —
Aus Ihren beiden letzten Briefen entnahm ich, — oder witterte ich? daß es irgend eine ungeheure Differenz zwischen uns giebt — nun, gar nichts Persönliches, alter lieber Freund, sondern etwas, das mit Zweck, Ziel und Erträglichkeit des Lebens zu thun hat. Nehmen Sie an, daß jenes Lebens-Gebet (kann ich’s wieder haben?) ein Commentar zur „fröhlichen Wissenschaft“ ist (eine Art Baß dazu). — Das Lied selber ist übrigens von Lou, sie gab es mir beim Abschied von Tautenburg (wo wir drei Wochen zusammen waren.)
Ich bleibe noch bis Ende des Monats hier. Romundt übernimmt eine Farben-Fabrik. Gersdorff schrieb mit Liebe von Ihnen, er scheint verlegen zu sein als Urheber des Weimarischen Plans. Von seiner Frau rühmt er „Schönheit Reinheit und Vernünftigkeit, welche ein sehr liebliches Wesen zusammen ausmachten“. — Jak<ob> Burckhardt will, daß ich „Professor der Weltgeschichte“ werde; ich lege seinen Brief bei.
Ihre Musik geht also weiter an Overbecks? Inzwischen aber will ich mich noch in diese Sonne setzen — ah, Freund, könnte ich Ihnen sagen, welche fünffache Finsterniß mich umhüllen will, und welchen Widerstand ich zu leisten habe. — Vermeiden Sie die Menschen! Unser Einer ist ein Glas, welches zu leicht einen Sprung bekommt — und dann ist es aus.
Ganz von Herzen
Ihr Freund F.N.
Neueste Nachricht: den 2. Oktober kommt L<ou>) hierher; ein Paar Wochen später reisen wir ab — nach Paris, und dort bleiben wir, vielleicht Jahre lang. — Mein Vorschlag.
308. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz (Postkarte)
Geehrtester Herr Verleger, haben Sie die Gefälligkeit, ein Exemplar meines letzten Buches an Frau Rothpletz, München, Fürstenstraße 13, zu senden. —
Das Geld ist in Naumburg bisher nicht eingetroffen; ich hätte es gern hierher: Leipzig, Auenstr. 26, 2te Etage — und recht bald.
Mit ergebenstem Gruße. Ihr
Professor Nietzsche.
309. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Mein lieber Freund, inzwischen werden Sie meinen Brief haben? Er kommt spät genug — aber es mißlang mir Einiges, bevor ich dazu kam, auch nur den ersten Ton Ihrer herrlichlieblichen Kunst zu genießen. Auch heute noch bin ich sehr unzufrieden in diesem Punkte: seit dem Zusammensein mit Riedel hörte ich nichts mehr: ich bin so unbekannt in Deutschland! Heute gehe ich zu Fritzsch (ich fand ihn schon 2mal nicht zu Hause) Ich trällere für mich oft die erste Gesangsnummer Ihres Werks, die mir wohl thut. — Seltsames Jahr! Ich habe in der letzten Woche etwas Haarsträubendes erlebt, aber ich ertrage Alles nachgerade und schwebe fast sofort wieder in die gute helle Höhe empor, immer sicherer meines Glaubens, daß mir Jedes zum Besten gereicht. Das Entgegenkommen von Erlebnissen, die zur Entwicklung meiner letzten Gedanken-Entscheidung führen, ist mir oftmals märchenhaft-sonderbar.
In Liebe und Dankbarkeit F. N.
310. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Lieber Freund, ich komme soeben von Kapellmeister N<ikisch>. Er zeigt die größte Bereitwilligkeit in Bezug auf „Sch<erz>, L<ist> und R<ache>“ und bittet unverzüglich um die Partitur. Geben Sie nach Weimar Auftrag, dieselbe an mich zu adressiren (damit es hier verborgen bleibt, daß sie von Weimar kommt.) Ich habe festgehalten, daß Sie nur als Pseudonym in dieser Sache auftreten, auch im geschäftlichen Verkehr. An Stägemann (Adresse einfach: Hr. St. Direktor des neuen Theaters) wenden Sie sich doch nicht eher, als bis N<ikisch> mit ihm gesprochen hat. Geht Alles schnell, so werde ich ihm in einem Besuche Ihren Brief und Ihre Bedingungen selber überbringen. — Sehr glücklich, Ihnen Hoffnung machen zu können
Ihr
F. N.
311. An Lou von Salomé in Stibbe
Meine liebe Lou,
wie geht es Ihren Augen? — Sie sollten vielleicht alle zwei Tage etwas schwimmen; wir haben hier zwei Schwimmbassins mit angenehmer Temperatur (20’), auch für Damen. —
Inzwischen habe ich die Aufführung einer Oper meines Venediger Freundes am Leipziger Theater kräftig in die Hand genommen; bisher gieng Alles gut, und man kommt mir auf das Artigste entgegen. Gesetzt, ich erreiche dies Ziel, so wird der Componist für diesen Winter nach Leipzig übersiedeln. —
In der That, der Riedelsche Verein wird das „Lebensgebet“* zur Aufführung bringen; Prof. Riedel ist äußerst davon eingenommen und arbeitet es eben für 4 stimmigen Chor um (was meine Augen nicht vertragen) Dabei ergab sich die Nothwendigkeit, an 2 Stellen den Text zu ändern: der I-Vokal ist nämlich überall, wo ein starker Accent in der Musik erreicht werden soll, unbrauchbar. — über die Musik selber schrieb Köselitz zuletzt noch: „ganz Manfred, groß, machtvoll, aber unheimlich.“ (das heißt: er mag sie nicht.) —
Auch Gersdorffs wollen nach Leipzig kommen; die „fröhliche Wissenschaft“ hat zwischen uns wieder alles in Ordnung gebracht, und mehr als das. G<ersdorff> schrieb, er denke so oft an Rée, und mit täglicher Dankbarkeit für den ausgezeichnet angenehmen Tabak.
Romundt, im Begriff abzureisen, will jedenfalls Ihre und Rée’s Ankunft noch abwarten. — Auch mit Dr. Ziel habe ich die Bekanntschaft wieder erneuert. — Die Hofräthin Heinze hat mir Studirzimmer und Bibliothek ihres Gatten zu Gebote gestellt, es ist eine alte Jugendgespielin von mir (eine ausnehmend scharfsinnige kleine Kratzbürste, mit der es Niemand aushält — mit Ausnahme meiner Wenigkeit)
Ich lege einen Ausschnitt aus einer Berliner Zeitung bei, interessant wegen der verschiednen Auffassung von Carmen. Endlich kommt man in Deutschland dahinter, daß diese Oper (die beste, die es giebt) eine Tragödie enthält! Ich kenne Frl. Lilli Lehmann persönlich; sie kam einmal nach Bayreuth, als ich gerade bei Wagners zu Besuche war, und ich habe ein paar Spaziergänge mit ihr gemacht. Falls ich hier etwas länger gebunden sein sollte, so werde ich mir auch schon die Aufführung von Carmen auswirken; dafür sitze ich wieder einmal etwas „an der Quelle“. Und Lilli muß dann die Hauptpartie singen, sie scheint ihre Sache teufelsmäßig gut zu machen. (Den Ausschnitt geben Sie mir doch in Leipzig wieder, bitte, gleich den 2 Briefen)
Aber was schwätze ich denn, meine liebe Lou, so viel mit der Feder! Fortsetzung mündlich. Und wann?
Von Herzen Ihnen zugethan
F.N.
(Auenstrasse 26, 2 Etage)
312. An Elisabeth Nietzsche in Tautenburg (Entwurf)
Diese Art von Seelen, wie Du eine hast, meine arme Schwester, mag ich nicht: und am wenigsten mag ich sie, wenn sie sich gar noch moralisch blähen, ich kenne Eure Kleinlichkeit. — Ich ziehe es bei weitem vor, von Dir getadelt zu werden.
313. An Franziska und Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Zettel)
Meine Lieben,
zufällig fand ich auf der Messe so delikaten Ingwer, daß ich nicht umhin kann, Euch ein Pfund davon zu schicken. Mit Zwieback zusammen gegessen, giebt er eine vorzügliche Speise ab. Auch sagt man dem Ingwer nach, daß er dem Gemüth gut thue.
F.
314. An Franziska Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Aber, meine liebe Mutter, wo bleiben denn meine Sachen? Der letzte Termin, den ich dafür gesetzt hatte, ist vorbei; und bei diesem Froste war die Abwesenheit des Schlafrocks hart (ich habe mich folglich erkältet) Ebenso brauche ich die Bücher (und die Fracks!). Nach Naumburg kann ich nicht kommen. — Es geht mir übrigens gut, und Alles geht vorwärts und glückt mir (es ist nun einmal ein Festjahr für mich): nur verwöhnt man mich hier, wie in Messina, von allen Seiten. Mit herzlichem Gruße
F.
Frl. Lou und Rée sind da, Köselitz wird erwartet, auch Gersdorffs wollen kommen.
315. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Aber, liebster Freund, sprechen Sie nicht so zu mir! ich komme mir sonst unerträglich vor, und zwar für die mir liebsten Menschen. Noch immer fehlt die Partitur. Oh Loën! Wenn ich ihm schreiben dürfte! — Lou und Rée sind eingetroffen: kommen Sie doch, sobald wir Nikisch’ für „Sch<erz>, L<ist> und R<ache>“ sicher sind, unverzüglich! Sie finden lauter friedliche und arbeitsame M<enschen>, die hoch und gut von Ihnen denken. — Der Riedelsche Verein wird mein „Lebensgebet“ (jetzt Chor) aufführen. — Heute Abend große Hauptleistung des Leipziger Spiritism, nach Befehl der Geister: welche behaupten, diese Sitzung werde für die Geschichte des Sp<iritismus> sehr wichtig sein: es werde eine Persönlichkeit in Betracht kommen — Genug, ich soll dabei sein, und es giebt 6 Personen, welche in Aufregung abwarten, was ich dazu sagen werde. Das beste „Medium“, aber hochschwanger. Heute werden die Geister „erscheinen“, zB. „die russische Nonne“ und das „Kind“. — Zwei Ärzte sind zugegen. Von Herzen Ihr
F. N.
316. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Lieber Freund, der Spiritism ist eine erbärmliche Betrügerei, welche nach der ersten halben Stunde langweilt. Und dieser Prof. Zöllner hatte sich von diesem Medium täuschen lassen! Kein Wort mehr davon! Ich hatte Anderes erwartet und war im Voraus mit 3 schönen physiologisch-psychologisch-moralischen Theorien sicher gestellt: aber ich brauchte meine Theorien gar nicht! — —
Partitur immer noch nicht da!
Ihr Freund F. N.
317. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Endlich, lieber Freund, ist die Partitur in meine Hände gelangt, und zwei Stunden später soll sie bei Kapellm. Nikisch abgegeben werden. —
Verdrießliches Wetter.
Von Herzen Ihr F. N.
Die P<artitur> sieht so rein und unberührt aus — — — —!
318. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Heute Morgen, lieber Freund, war ich wieder bei Nikisch, aber er hatte die Partitur noch nicht angesehn ((überhäuft von Einstudiren Manfreds (nächste Woche), der Meistersinger und Rubinsteins Maccabäer (Anfang November)) Ich habe ihm gesagt, Sie wollten so schnell wie möglich herkommen, ihm etwas vorspielen, usw. was ihn sehr zu freuen schien; er lud mich ein, dabei zugegen zu sein — (was ich, mit Ihrer gütigen Erlaubniß, gerne annehmen würde!) In der That, Eile ist nöthig; die zwei Wochen Loënscher Bummelei waren ein Malheur. Morgen will ich zu Stägemann gehen; das Winterhalbjahr geht eben schon los! Schreiben Sie mir umgehend, ob Sie kommen können (ich zweifle eigentlich nicht, daß wir’s hier durchsetzen, aber ich bin vielleicht ein „Phantast“!)
Auf Wiedersehn, liebster Freund!
F.N.
319. An Franziska und Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Die schöne Torte hättet Ihr mir nicht senden sollen: jedenfalls danke ich herzlich dafür. — Mit dem 15. Okt. begann der Winter. — Herr Köselitz ist angekommen und macht die schönste Musik. — Morgen werden wir zusammen das große R<ichard>-Wagner-Concert besuchen (ausverkauft) in dem die Bayreuther Künstler auftreten; es giebt ein Stück Parsifal, unter vielem Andern, zu hören.
Mit besten Grüßen
F. N.
320. An Heinrich Romundt in Neuenstaden bei Freiburg (Fragment)
Nietzsche meldet ... die Abreise des Fräuleins Lou Salomé von Leipzig als dieselbe Woche noch bevorstehend ... In eben dem selben Brief aber hatte Nietzsche ... bereits geschrieben: Lou, ganz in religionsgeschichtliche Betrachtungen versenkt, ist ein kleines Genie, dem hier und da ein wenig zuzusehen und förderlich zu sein ein Glück für mich ist. [+ + +]
321. An Lou von Salomé in Leipzig (Widmung)
Freundin — sprach Kolumbus — traue
Keinem Genueser mehr!
Immer starrt er in das Blaue,
Fernstes zieht ihn allzusehr!
***
Wen er liebt, den lockt er gerne
Weit hinaus in Raum und Zeit — —
über uns glänzt Stern bei Sterne,
Um uns braust die Ewigkeit.
***
Meiner lieben Lou.
322. An Heinrich von Stein in Halle
Geehrtester Herr Doctor,
ich bin Ihres Besuchs verlustig gegangen, das thut mir Leid — ein Brief rief mich an jenem Tage von Leipzig weg. —
Darf ich mir erlauben, Ihnen heute die Aushängebogen meines letzten Buches zuzusenden? So haben Sie wenigstens eine Möglichkeit, sich mit mir auch in Halle unterhalten zu können (eine andere Möglichkeit, daß ich einmal zu Ihnen komme, vorbehalten).
Man hat mir erzählt, daß Sie, mehr als jemand sonst vielleicht, sich Schopenhauern und Wagnern mit Herz und Geist zugewendet haben. Dies ist etwas Unschätzbares, vorausgesetzt, daß es seine Zeit hat.
Ihnen von Herzen zugethan
Dr. Nietzsche.
323. An Louise Ott in Paris
Verehrungswürdige Freundin,
Oder darf ich nach sechs Jahren dieses Wort nicht mehr gebrauchen?
Inzwischen habe ich dem Tode näher gelebt, als dem Leben und bin folglich ein wenig zu sehr zum „Weisen“ und beinahe zum „Heiligen“ geworden ...
Indessen: das läßt sich vielleicht noch corrigiren! Denn ich glaube wieder an das Leben, an die Menschen, an Paris, sogar an mich selber — und will in kurzer Zeit Sie wiedersehen. Mein letztes Buch heißt: „Die fröhliche Wissenschaft“.
Giebt es viel heiteren Himmel über Paris? Wissen Sie durch Zufall etwa von einem Zimmer, das für mich paßt? Es müßte ein todtenstill gelegenes, sehr einfaches Zimmer sein. Und nicht gar zu ferne von Ihnen, meine liebe Frau Ott.
Oder rathen Sie mir ab, nach Paris zu kommen? Ist es kein Ort für Einsiedler, für Menschen, die still mit einem Lebenswerke herumgehen wollen und sich gar nicht um Politik und Gegenwart bekümmern?
Sie sind mir eine so liebliche Erinnerung!
Von Herzen Ihnen zugethan
Professor Dr. F. Nietzsche
324. An August Sulger in Paris
Geehrtester Herr Doctor,
der Himmel weiss, was aus meiner Übersiedelung nach Paris werden soll, wenn Sie mir nicht die Hand ein wenig entgegenstrecken wollen. Zudem sagt Goethe „edel sei der Mensch, hülfreich und gut“ — und die Basler sind es gar nicht so selten, nach meiner Erfahrung zu urtheilen. - - -
Ich würde also, ungefähr in 10 Tagen, in Paris eintreffen, eines Morgens gegen 10 Uhr (Leipzig — Frankfurt — Paris) — vorausgesetzt, daß Sie mich Halb-Blinden dort empfangen und „einschiffen“ wollen! Ein Zimmer, sehr einfach, aber in der stillsten Umgebung, so etwas Todtenstilles, wie es sich für mich Einsiedler und Gedanken-Wurm passt: vielleicht ist Ihnen etwas der Art durch Zufall bekannt. Sonst müssen wir’s suchen.
Schreiben Sie mir ein Wort, ob Sie guten Willen haben oder nicht: Sie bekommen dann zur rechten Zeit eine definitive Mittheilung über den Tag meiner Ankunft.
Werden Sie mich wieder erkennen? Oder müssen wir „ein rosa Bändchen“ verabreden, mein werther Herr Doctor?
Mit herzlichem Grusse
Prof. Dr.Nietzsche
Leipzig, Auenstrasse 26, 2te Etage.
325. An Lou von Salomé vermutlich in Berlin
Liebe Lou, fünf Worte — meine Augen schmerzen.
Ich besorgte Ihren Petersburger Brief. Vor zwei Tagen habe ich auch an Ihre Frau Mutter geschrieben (und zwar ziemlich lang)
Auch nach Paris habe ich zwei Anfrage-Briefe abgeschickt. —
Welche Melancholie!
Ich wußte es nicht bis zu diesem Jahre, wie sehr ich mißtrauisch bin. Nämlich gegen mich. Der Umgang mit Menschen hat mir den Umgang mit mir verdorben.
Sie wollten mir noch Etwas sagen?
Ihre Stimme gefällt mir am meisten, wenn Sie bitten. Aber man hört dies nicht oft genug.
Ich werde beflissen sein — —
Ah, diese Melancholie! Ich schreibe Unsinn. Wie seicht sind mir heute die Menschen! Wo ist noch ein Meer, in dem man wirklich noch ertrinken kann! Ich meine ein Mensch.
Meine liebe Lou
ich bin Ihr —
getreuer — —
F.N.
(An Rée und Frau Rée das Herzlichste!)
326. An Hermann Levi in München
Verehrter Herr Kapellmeister,
ich denke doch, Sie haben mich irgend wie noch im Gedächtniß, wenn auch nur wie einen Schatten, der sich nicht entschließen kann, ganz der Unterwelt anzugehören? Wirklich lebte ich Jahrelang dem Tode näher als dem Leben und gab mir in diesem Zeitraume alle die Privilegien der Sterbenden — namentlich das, „die Wahrheit zu sagen.“
Jetzt wo ich wieder zum Leben erwacht bin, vielleicht zum Lang-Leben — kann ich mich noch der guten Gewohnheit, die ich eben nannte, noch nicht losmachen: wovon Sie sogleich eine Probe bekommen sollen. Also: ich glaube daran, daß es hundert mal bessere Musik geben könnte als die Wagners ist
Pardon! — —
Dies bringt mich dazu, Ihnen einen Freund anzuempfehlen, welcher in Kürze nach München geht, um — Ihnen zuzusehn und zuzuhören, wenn Sie dirigiren. Er will auf diese Weise von Ihnen lernen und bittet mich, Sie, hochverehrter Herr Kapellmeister, für ihn gnädig zu stimmen. Aber wie soll ich dies machen! Ganz leise ins Ohr geflüstert: dieser Musiker, Herr Peter Gast, scheint mir der neue Mozart.
Ich denke einigermaßen zu wissen, welchen Schüler ich zu welchem Lehrer schicke. (Lateinische Construktion — )
Von Herzen der Ihrige
Prof. Dr. Friedr. Nietzsche.
Leipzig Auenstrasse 26 2te Etage.
327. An Franz Overbeck in Basel
Mein lieber Freund, so geht es! Ich schrieb nicht, um die Entscheidung in mehreren Dingen abzuwarten, und heute schreibe ich, nur um Dir dies zu sagen; denn es ist noch nichts entschieden. Noch nicht einmal in Betreff meiner Reise- und Winter-Pläne. Paris steht immer zwar noch im Vordergrund, aber es ist kein Zweifel, daß mein Befinden unter dem Eindrucke dieses nordischen Himmels sich verschlechtert hat; und vielleicht habe ich nie so melancholische Stunden durchgemacht, wie in diesem Leipziger Herbst — obwohl ich doch Gründe genug um mich habe, guter Dinge zu sein. Genug, es gab manchen Tag, wo ich im Geiste über Basel wieder meerwärts reiste. Ich fürchte mich vor dem Lärme von Paris etwas und möchte wissen, ob es genug heiteren Himmel hat. Andererseits würde in einer erneuten Genueser Einsamkeit manche Gefahr liegen. — — Ich gestehe, ich würde überaus gerne Dir und Deiner lieben Frau einen längeren Bericht über die Erfahrungen dieses Jahres gemacht haben: es giebt sehr viel zu erzählen, und wenig zu schreiben.
Für das Buch von Jans<s>en bin ich Dir großen Dank schuldig, es präcisirt vorzüglich alles Unterscheidende zwischen seiner und der protestantischen Auffassung (der ganze Handel läuft auf eine Niederlage des deutschen Protestantism hinaus — jedenfalls der protestantischen „Geschichtsschreibung“) Ich selber habe in der Hauptsache nicht viel umzulernen gehabt. Die Renaissance bleibt mir immer noch die Höhe dieses Jahrtausends; und was seither geschah, ist die große Reaktion aller Art von Heerden-Trieben gegen den „Individualismus“ jener Epoche.
Lou und Rée sind in diesen Tagen abgereist, zunächst um mit Mutter Rée sich in Berlin zu treffen: von da geht es nach Paris. Mit der Gesundheit von Lou steht es bejammernswürdig, ich gebe ihr nun viel kürzere Zeit als noch in diesem Frühjahr. Wir haben unser gut Theil Sorge; Rée ist wie geschaffen für seine Aufgabe in dieser Sache. Für mich persönlich ist L<ou> ein wahrer Glücksfund, sie hat alle meine Erwartungen erfüllt — es ist nicht leicht möglich, daß zwei Menschen sich verwandter sein können als wir es sind.
Was Köselitz (oder vielmehr Herrn „Peter Gast“) betrifft, so ist hier mein zweites Wunder dieses Jahres. Während Lou für den bisher fast verschwiegenen Theil meiner Philosophie vorbereitet ist, wie kein anderer Mensch, ist Köselitz die tönende Rechtfertigung für meine ganze neue Praxis und Wiedergeburt — um einmal ganz egoistisch zu reden. Hier ist ein neuer Mozart — ich habe keine andre Empfindung mehr: Schönheit Herzlichkeit Heiterkeit Fülle Erfindungs-Überfluß und die Leichtigkeit der contrapunktischen Meisterschaft — das fand sich noch nie so zusammen, ich mag bereits gar keine andre Musik mehr hören. Wie arm, künstlich und schauspielerisch klingt mir jetzt die ganze Wagnerei! — Ob Sch<erz> L<ist> und R<ache> hier aufgeführt wird? Ich glaube es, aber weiß es noch nicht. —
Dies Bild, welches ich beilege, mag auf Deinem Geburtstagstisch zu finden sein (es wird als Photographie bewundert.)
Hat Frau Rothpletz mein letztes Buch empfangen? Ich vergaß ihre genaue Adresse.
Von Herzen Dir ein gutes Jahr wünschend Dein Freund
Nietzsche
328. An Louise Ott in Paris
Oh, meine verehrte Freundin, kaum habe ich Ihnen gesagt, daß ich komme, muß ich Ihnen melden, daß ich noch lange nicht komme, — daß immer noch ein paar Monate hinlaufen können.
Komme ich aber, dann auf lange! — und kann ich nicht im Herzen von Paris leben, dann vielleicht in St.-Cloud oder St.-Germain, wo ein Einsiedler und Gedanken-Wurm besser sein stilles Wesen treiben kann.
Von ganzem Herzen Ihnen dankbar
Friedrich Nietzsche.
329. An August Sulger in Paris
Lieber Herr Doctor,
wie liebenswürdig Sie geschrieben haben! Aber mit meiner Reise hat es noch gute Weile. Dies dumme Winter-Wetter setzt mir so zu, dass ich die Lust verliere, es mit dem Norden und seinen bedeckten Himmeln länger aufzunehmen. Die Gesundheit sagt „geh nach Süden“ — Hoffentlich sagt sie mir im Frühling „geh nach Paris“.
Dann hoffe ich Ihnen die Hand zum Danke schütteln zu können.
Mit herzlichem Gruß
Ihr
Prof. D. Nietzsche
330. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz
Werthester Herr Verleger,
es handelt sich um einen Auftrag — er will von Ihnen meine Photographie, (die große)
Meine Adresse: Genova (Italia) poste restante.
Abreise heute.
Prof. Nietzsche
330a. An Gustav Dannreuther in Boston
Sehr geehrter Herr,
erst auf die Anregung Ihres Briefes giebt es wieder Bilder von mir — und wie man sagt sehr ähnliche Bilder. Das Ähnlichste Bild aber geben meine Schriften, vorausgesetzt daß sie mit jenem liebevollen Eifer als Ganzes geschaut und empfunden werden, der aus Ihren Worten zu mir spricht. Und was Alles von meinen Gedanken widerlegbar sein mag: — die Person selber ist etwas Unwiderlegbares. Auch Irrthümer haben Werth, wenn sie dazu beitragen, das ganze Bild meiner Persönlichkeit zu geben.
Ich gab meinem Verleger Auftrag, Sie über meine neueren Schriften in Kenntniß zu setzen. Die letzte heißt „die fröhliche Wissenschaft“ — ein Titel, der Ihnen als einem Anhänger Schopenhauers fremd und seltsam klingen mag. Aber es ist eine gute Sache um alle Fröhlichkeit.
Von Herzen Ihnen zugethan
Prof. Dr. F. Nietzsche
Adresse: Genova (Italia) poste restante.
331. An Carl von Gersdorff in Ostrichen
Mein alter lieber Freund,
heute Nacht geht es wieder südwärts, zu meiner Residenz Genua. Mir bekommt Norden und Winter nicht — ich habe die Pariser Pläne zurückgelegt (trotzdem daß Mad. Ott mir vorgestern Blumen schickte)
Deine letzte Briefe thaten mir sehr gut, ich danke Dir von ganzem Herzen.
Dein Freund F.N.
Adresse: Genova poste restante.
332. An Heinrich Köselitz in Leipzig (Postkarte)
Meine Adresse ist nunmehr
Santa Marguerita, Ligure
ferma in posta.
Meine herzlichsten Wünsche sind bei Ihnen, Freund! Hoffentlich gelingt Ihnen das Leben etwas besser als mir. Ich bin auch hier noch nicht über den Alpdruck hinaus, den dies Jahr brachte.
Ihr F. N.
Kalt. Krank. Ich leide.
333. An Franz Overbeck in Basel (Postkarte)
Liebe Freunde, inzwischen gieng es nicht gut. Gotthardreise eisig kalt, ohne Heizung. Meine Wohnung in Genua fand ich vermiethet, Genua selber eisig-kalt und regnerisch, Alles mißrieth mir. Endlich reiste ich nach Porto fino ab und blieb in Santa Marguerita. Am andern Tage (bis jetzt) heftiger Anfall des Kopfleidens, mit Erbrechen usw Mein Zimmer eisig kalt, wie alle Reise-Eindrücke. Trotzdem weiß ich nichts Besseres als zu bleiben. „Gram“ ist allzeit bei mir — heißt es irgendwo (bei Shakespeare?) Bitte mir, was noch kommt, zu senden nach Santa Marguerita Ligure, poste restante.
Heute / Ich leide.
Dein F.N.
Das Leben bei Euch war die Oase. — —
334. An Paul Rée, vermutlich in Berlin
Aber, lieber, lieber Freund, ich meinte, Sie würden umgekehrt empfinden und sich im Stillen darüber freuen, mich für eine Zeit los zu sein! Es gab in diesem Jahre hundert Augenblicke, von Orta an, wo ich empfand, daß Sie die Freundschaft mit mir etwas „zu hoch bezahlen“. Ich habe schon Viel zu Viel von Ihrem römischen Funde abbekommen (ich meine Lou) — und es schien mir immer, namentlich in Leipzig, daß Sie ein Recht hätten, gegen mich ein wenig schweigsam zu werden.
Denken Sie, liebster Freund, so gut als möglich von mir, und bitten Sie auch Lou um eben dasselbe für mich. Ich gehöre Ihnen Beiden mit meinen herzlichsten Gefühlen — ich meine dies durch meine Trennung mehr bewiesen zu haben als durch meine Nähe.
Alle Nähe macht so ungenügsam — und ich bin zuletzt überhaupt ein ungenügsamer Mensch.
Von Zeit zu Zeit werden wir uns schon wiedersehen, nicht wahr? Vergessen Sie nicht, daß ich von diesem Jahre an plötzlich arm an Liebe und folglich sehr bedürftig der Liebe geworden bin.
Schreiben Sie mir etwas recht Genaues über das, was uns jetzt am meisten angeht, — was „zwischen uns steht“, wie Sie schreiben.
In ganzer Liebe
der Ihre
F.N.
NB. Ich lobte Sie so in Basel, daß Frau Overbeck sagte: „Aber Sie beschreiben ja Daniel De Ronda!“ Wer ist Daniel De Ronda?
Adr.: Santa Marguerita Ligure
poste restante.
335. An Lou von Salomé, vermutlich in Berlin
Meine liebe Lou,
gestern habe ich den beifolgenden Brief an Rée geschrieben: und eben war ich unterwegs, ihn zur Post zu tragen — da fiel mir etwas ein, und so habe ich das Couvert wieder abgerissen. Dieser Brief, der Sie allein betrifft, würde R<ée> vielleicht mehr Schwierigkeit machen als Ihnen; kurz, lesen Sie ihn, es soll ganz in Ihrer Hand stehen, ob R<ée> ihn auch lesen soll. Nehmen Sie dies als ein Zeichen des Vertrauens, meines reinsten Willens zum Vertrauen zwischen uns!
Und nun, Lou, liebes Herz, schaffen Sie reinen Himmel! Ich will nichts mehr, in allen Stücken als reinen hellen Himmel: sonst will ich mich schon durchschlagen, so hart es auch geht. Aber ein Einsamer leidet fürchterlich an einem Verdachte über die Paar Menschen, die er liebt — namentlich wenn es der Verdacht über einen Verdacht ist, den sie gegen sein ganzes Wesen haben. Warum fehlte bisher unserm Verkehre alle Heiterkeit? Weil ich mir zu viel Gewalt anthun mußte: die Wolke an unsrem Horizonte lag auf mir!
Sie wissen vielleicht, wie unerträglich mir alles Beschämenwollen, alles Anklagen und Sich-Vertheidigen-müssen ist. Man thut viel Unrecht, unvermeidlich — aber man hat ja auch die herrliche Gegenkraft, wohlzuthun, Frieden und Freude zu schaffen.
Ich fühle jede Regung der höheren Seele in Ihnen, ich liebe nichts an Ihnen als diese Regungen. Ich verzichte gerne auf alle Vertraulichkeit und Nähe, wenn ich nur dessen sicher sein darf: daß wir uns dort einig fühlen, wohin die gemeinen Seelen nicht gelangen.
Ich spreche dunkel? Habe ich erst das Vertrauen, so sollen Sie schon erleben, daß ich auch die Worte habe. Bisher habe ich immer schweigen müssen.
Geist? Was ist mir Geist! Was ist mir Erkenntniß! Ich schätze nichts als Antriebe — und ich möchte darauf schwören, daß wir darin etwas Gemeinsames haben. Sehen Sie doch durch diese Phase hindurch, in der ich seit einigen Jahren gelebt habe — sehen Sie dahinter! Lassen Sie sich nicht über mich täuschen — Sie glauben doch nicht, daß „der Freigeist“ mein Ideal ist?! Ich bin —
Verzeihung! Liebste Lou!, seien Sie, was Sie sein müssen.
F.N.
336. An Unbekannt: Lou von Salomé? (Disposition)
Fritz
„So ihr nicht werdet
— Overbecks
— Manfred
— Ein Mann in eines Kindes Hut!
— damals war ich furchtbar eingeklemmt
(scheinbar verloren)
— meinen Schriften nicht immer gewachsen
— ohne Vater und Berather
— Nilson
— Rée
— Wetter Stimmung Objekte zb Lou
— bei mir ist jetzt die Spitze allen moral<ischen> Nachdenkens und Arbeitens in Europa
— ich war auf Einmal
Philolog, Schriftsteller Musiker Philosoph
Freidenker usw (vielleicht Dichter? usw).
— Skobeleff
— Vorträge in Leipzig
— mit Fürsten
— gut, edel, groß.
— Mitleid meine schwache Partie. Wenn Sie sagten: ich werde bald sterben usw
— Bescheidenheit. Ich werde von mir überrascht.
— „bezaubernd wahrlich ist der Fraß
„bezaubernder noch, wer ihn aß.“
Idyl<len> aus Messina Psychol<ogisches> Problem 2 Zeiten. Ich fürchtete mich und überwand mich. Ich will mich nicht mehr verhehlen. So etwas Junges Anmuthiges Leichtsinniges Tiefes Unbeständiges — macht mich weinen.
Wo die Noth am größten, ist L<ou> am nächsten (in Genua über Bayreuth denkend, kein einziger neuer Antrieb)
für mich ein Adler
die Worte liebkosen und streicheln
wie mit meinem Dämonion reden
was thut noth zur Größe?
unerträglich mir, wehe zu thun zb. durch jenes Schweigen.
— Genua Dirne
Kühe, Katzen und Vögel
337. An Lou von Salomé in Berlin (Entwurf)
Was machen Sie, meine liebe L<ou> ich bat um heitern Himmel zwischen uns
soll ich sagen: es ist vorbei
Wollen wir uns zusammen erzürnen? haben wir Lust einen großen Lärm zu machen? Ich ganz und gar nicht, ich wollte heitren Himmel zwischen uns. Aber Sie sind ja ein kleiner Galgenvogel! Und einst hielt ich Sie für die leibhaftige Tugend und Ehrbarkeit.
338. An Lou von Salomé in Berlin (Entwurf)
M<eine> l<iebe> L<ou> ich muß Ihnen einen kleinen boshaften Brief schreiben. Um des Himmels Willen, was denken denn diese kleinen Mädchen von 20, welche angenehme Liebesgefühle haben und nichts Weiteres zu thun haben als hier und da krank zu sein und zu Bett zu liegen? Soll man diesen kl<einen> M<ädchen> viell<eicht> noch nachlaufen, um ihnen die Langeweile und die Fliegen zu verjagen? Zufällig Einen netten Winter zu machen<?> Charmant: aber was habe ich mit netten Wintern zu thun? Sollte ich die Ehre haben, dazu beizutragen
339. An Paul Rée in Berlin (Entwurf)
Seltsam! Ich habe über L<ou> eine vorgefaßte Meinung: und obwohl ich sagen muß, daß alle meine Erfahrung aus diesem Sommer widerspricht, werde ich diese Meinung nicht los. Eine Reihe von höheren Gefühlen, welche unter M<enschen> sehr selten und sehr auszeichnend sind, müssen in ihr vorhanden sein oder gewesen sein: irgend ein Haupt-Unglück
Eigentlich hat sich Niemand in meinem Leben so häßlich gegen mich benommen wie L<ou>. Bis heute hat sie jene abscheuliche Verunglimpfung meines ganzen Charakters und Willens nicht widerrufen, mit der sie sich in Jena und Tautenb<urg> einführte: und dies obwohl sie weiß, daß es mir in seiner Nachwirkung erheblichen Schaden zugefügt hat (Namentl<ich> in Bezug auf Basel) Wer mit einem Mädchen das solche Dinge sagt, nicht den Verkehr abbricht, der muß ja — ich weiß nicht was sein — so schließt man. Daß ich es nicht that, war die Folge jener vorgefaßten Meinung: übrigens von mir ein gutes Stück Selbstüberwindung.
R<ohde> der mir kürzlich vorgehalten hat, diese meine ganze neuere Denkweise sei ein exc<entrischer> Entschluß nennt mich einen Tausendkünstler der Selbstüberwindung.
Was mir übrigens am schwersten wird, ist, daß ich weder mit Ihnen noch mit Lou noch mit irgend jemandem von dem reden kann, was mir am meisten auf dem Herzen liegt.
Wie ich einen Mann behandeln würde, der so über mich zu meiner Schwester redete, darüber ist gar kein Zweifel. Darin bin ich Soldat und werde es immer sein, ich verstehe mich auf Waffen. Aber ein Mädchen! Und Lou!
sie hat mich in Bayreuth nicht nur im Stich gelassen, sondern geringschätzig behandelt (meine Schwester erzählte 100 Geschichten) — in diesem Punkte bin ich empfindlich, denn daß meine Freunde mein Verhalten gegen W<agner> zu würdigen und mir Recht darin zu schaffen wissen, das gehört für mich zum Begriff „mein Freund“
wer diese Dinge nicht begreift der weiß nichts davon was es heißt „der Erkenntniß Opfer bringen“
Können Sie diese Dinge nicht ins Gleiche bringen? Ich habe nie mit Lou davon sprechen wollen einen einzigen Punkt ausgenommen, von dem Sie wissen.
In der Hauptsache, wollte ich ihr die Freiheit lassen, das Geschehene von sich aus wieder gut zu machen: mir ist alles Erzwungene zwischen 2 Personen gräßlich.
Als ich sie das letzte Mal sah, sagte sie mir, sie habe mir noch etwas mitzutheilen. Ich war voller Hoffnung. (Ich sagte zu meiner S<eele> „Sie hat eine sehr schlechte Meinung von mir aber sie ist klug, sie wird bald eine bessere bekommen“
ich möchte daß die schmerzhafteste Erinnerung dieses Jahres mir von der Seele genommen würde — schmerzhaft nicht, weil sie mich beleidigt sondern weil sie Lou in mir beleidigt.
340. An Unbekannt: Paul Rée? (Entwurf)
Das unglaubliche Resultat dieses Sommers, daß L<ou> mich meinen Angehörigen und den Baslern verdächtigt hat und ich nun behandelt werde als niedrig gesinnter M<ensch> der noch dazu auf Schleichwegen geht —
Auch geht ein solches Zusammenleben wider meinen Geschmack — — —
341. An Unbekannt: Paul Rée? (Entwurf)
Ich habe den Ehrgeiz eines weltlichen Heiligen — aber Sie und alle Andern haben mich im letzten Jahre sehr mißtrauisch gegen mich selber gemacht. Und im Verdruß über dies Mißtrauen war ich nahe daran zu Grunde zu gehn.
Nun hat Lou das Gerede in Umlauf gesetzt durch Frau Gelzer und meine Schwester
gerade Lou!
Das ist eine Grausamkeit des Schicksals.
Mitleid Hölle.
Ertragen im Schweigen; — Selbstüberwindung
342. An Heinrich von Stein in Halle
Aber, lieber Herr Doctor, Sie hätten mir gar nicht schöner antworten können, als Sie es gethan haben — durch Übersendung Ihrer Bogen. Das traf glücklich zusammen! Und bei allen ersten Begegnungen sollte es ein so gutes „Vogelzeichen“ geben!
Ja, Sie sind ein Dichter! Das empfinde ich: die Affekte, ihr Wechsel, nicht am wenigsten der scenische Apparat — das ist wirksam und glaubwürdig (worauf Alles ankommt!)
Was die „Sprache“ betrifft, — nun wir sprechen zusammen über die Sprache, wenn wir uns einmal sehen: das ist nichts für den Brief. Gewiß, lieber Herr Doctor, Sie lesen noch zu viel Bücher, namentlich deutsche Bücher! Wie kann man nur ein deutsches Buch lesen!
Ah, Verzeihung! Ich that es selber eben und habe Thränen dabei vergossen.
Wagner sagte einmal von mir, ich schriebe lateinisch und nicht deutsch: was einmal wahr ist und sodann — auch meinem Ohre wohlklingt. Ich kann nun einmal an allem deutschen Wesen nur einen Antheil haben, und nicht mehr. Betrachten Sie meinen Namen: meine Vorfahren waren polnische Edelleute, noch die Mutter meines Großvaters war Polin. Nun, ich mache mir aus meinem Halbdeutschthum eine Tugend zurecht und nehme in Anspruch, mehr von der Kunst der Sprache zu verstehen als es Deutschen möglich ist. —
Also hierin auf Wiedersehn!
Was „den Helden“ betrifft: so denke ich nicht so gut von ihm wie Sie. Immerhin: er ist die annehmbarste Form des menschlichen Daseins, namentlich wenn man keine andre Wahl hat.
Man gewinnt etwas lieb: und kaum ist es Einem von Grund aus lieb geworden, so sagt der Tyrann in uns (den wir gar zu gerne „unser höheres Selbst“ nennen möchten): „Gerade das gieb mir zum Opfer.“ Und wir geben’s auch — aber es ist Thierquälerei dabei und Verbranntwerden mit langsamem Feuer. Es sind fast lauter Probleme der Grausamkeit, die Sie behandeln: thut dies Ihnen wohl? Ich sage Ihnen aufrichtig, daß ich selber zuviel von dieser „tragischen“ Complexion im Leibe habe, um sie nicht oft zu verwünschen; meine Erlebnisse im Kleinen und Großen, nehmen immer den gleichen Verlauf. Da verlangt es mich am meisten nach einer Höhe, von wo aus gesehen das tragische Problem unter mir ist. — Ich möchte dem menschlichen Dasein etwas von seinem herzbrecherischen und grausamen Charakter nehmen. Doch, um hier fortfahren zu können, müßte ich Ihnen verrathen, was ich Niemandem noch verrathen habe — die Aufgabe, vor der ich stehe, die Aufgabe meines Lebens. Nein, davon dürfen wir nicht mit einander sprechen. Oder vielmehr: so wie wir Beide sind, zwei sehr getrennte Wesen, dürfen wir davon nicht einmal mit einander schweigen.
Von Herzen Ihnen dankbar
und zugethan
F. Nietzsche.
Ich bin wieder in meiner Residenz Genua oder in deren Nähe, mehr Einsiedler als je: Santa Margherita Ligure (Italia) (poste restante).
343. An Heinrich Köselitz in Leipzig
Mein lieber Freund,
trotz alledem — will ich die letzten Wochen nicht zum zweiten Male erleben.
Auch habe ich gefroren wie nie im Leben. Endlich flüchtete ich in ein Albergo, unmittelbar am Meere, und mein Zimmer hat einen Kamin.
Mein Reich erstreckt sich jetzt von Portofino bis Zoagli; ich wohne in der Mitte, nämlich in Rapallo, aber meine Spaziergänge führen mich täglich an die genannten Grenzen meines Reichs. Der Hauptberg der Gegend, von meiner Wohnung an aufsteigend, heißt „der fröhliche Berg“, Monte allegro: ein gutes omen — hoffe ich.
Kommen Sie ja diesmal über Genua — wir treffen es im Leben nicht wieder so. Ich werde Ihnen, wie der Teufel, alle „Herrlichkeiten der Welt“ zeigen und will Sie damit nicht einmal „verführen“! —
Heinrich von Stein schrieb an mich, sehr verstummt (nicht verstimmt, wie es schien) und „mit ehrfurchtsvollem Gruße“.
Aber was werden Sie sagen: ich habe einen neuen Anhänger — nämlich Hans von Bülow („hingebende Theilnahme“ für mich)
Die Welt ist rund und muß sich drehn: machen wir „gute Musik“ dazu, alter Freund! Hier und da glaubt man wohl, man dürfe auch selber ein wenig mittanzen, aber Niemand will mit diesen Leierkasten-Männern tanzen — dazu sind sie nicht da.
Addio, es lebe der Gott Italiens.
Ihr Freund F N.
Ihrem Herrn Vater meine Verehrung und Dankbarkeit — Dank dafür, daß Herr Peter Gast da ist und daß er der und der ist! —
Adresse immer dieselbe, Santa Margherita Ligure.
344. An Hans von Bülow in Meiningen
Hochverehrter Herr,
durch irgend einen guten Zufall erfahre ich, daß Sie mir — trotz meiner entfremdenden Einsamkeit, zu der ich seit 1876 genöthigt bin — nicht fremd geworden sind: ich empfinde eine Freude dabei, die ich schwer beschreiben kann. Es kommt zu mir wie ein Geschenk und wiederum wie etwas, auf das ich gewartet, an das ich geglaubt habe. Es schien mir immer, sobald Ihr Name mir einfiel, daß es mir wohler und zuversichtlicher um’s Herz werde; und wenn ich zufällig etwas von Ihnen hörte, meinte ich gleich es zu verstehn und gutheißen zu müssen. Ich glaube, ich habe wenige Menschen so gleichmäßig in meinem Leben gelobt wie Sie — Verzeihung! Was habe ich für ein Recht, Sie zu „loben“! — —
Inzwischen lebte ich Jahre lang dem Tode etwas zu nahe und, was schlimmer ist, dem Schmerze. Meine Natur ist gemacht, sich lange quälen zu lassen und wie mit langsamem Feuer verbrannt zu werden; ich verstehe mich nicht einmal auf die Klugheit, „den Verstand dabei zu verlieren“. Ich sage nichts von der Gefährlichkeit meiner Affekte, aber das muß ich sagen: die veränderte Art zu denken und zu empfinden, welche ich seit 6 Jahren auch schriftlich zum Ausdruck brachte, hat mich im Dasein erhalten und mich beinahe gesund gemacht. Was geht es mich an, wenn meine Freunde behaupten, diese meine jetzige „Freigeisterei“ sei ein excentrischer, mit den Zähnen festgehaltener Entschluß und meiner eigenen Neigung abgerungen und angezwungen? Gut, es mag eine „zweite Natur“ sein: aber ich will schon noch beweisen, daß ich mit dieser zweiten Natur erst in den eigentlichen Besitz meiner ersten Natur getreten bin. —
So denke ich von mir: im Übrigen denkt fast alle Welt recht schlecht von mir. Meine Reise nach Deutschland in diesem Sommer — eine Unterbrechung der tiefsten Einsamkeit — hat mich belehrt und erschreckt. Ich fand die ganze liebe deutsche Bestie gegen mich anspringend — ich bin ihr nämlich durchaus nicht mehr „moralisch genug.“
Genug, ich bin wieder Einsiedler und mehr als je; und denke mir — folglich — etwas Neues aus. Es scheint mir, daß allein der Zustand der Schwangerschaft uns immer wieder an’s Leben anbindet. —
Also: ich bin, der ich war, Jemand der Sie von Herzen verehrt
Ihr ergebener
Dr. Friedrich Nietzsche
(Santa Margherita Ligure |Italia| poste rest.)
345. An Erwin Rohde in Tübingen
Mein lieber Freund,
so bin ich doch wieder im „Süden“; ich kann immer noch nicht nordischen Himmel, Deutschland und „die Menschen“ vertragen. Es gab sehr viel Krankheit und Melancholie inzwischen.
Bei Deinem mir äußerst willkommenen Briefe, der mich in Santa Margarita erwischte, hatte ich namentlich Eine Freude: Dich von einer concentrirenden Haupt-Arbeit reden zu hören. Im Grunde zürne ich allen meinen Freunden im Stillen, bevor ich nicht dies Wort von ihnen höre. Wir müssen uns in etwas Ganzes hineinlegen, sonst macht das Viele aus uns ein Vieles.
Ich schreibe heute auch so schlecht wie gewisse Freunde — und nicht einmal aus Rache. —
Was mich betrifft — liebsten Freund, sieh zu, daß Du gerade jetzt nicht über mich in den Irrthum geräthst. Gut, ich habe eine „zweite Natur“, aber nicht um die erste zu vernichten, sondern um sie zu ertragen. An meiner „ersten Natur“ wäre ich längst zu Grunde gegangen — war ich beinahe zu Grunde gegangen.
Was Du von dem „excentrischen Entschluß“ sagst, ist übrigens vollkommen wahr. Ich könnte Ort und Tag dazu nennen. Aber — wer war es doch, der sich da entschloß? — Gewiß, liebster Freund, es war die erste Natur: sie wollte „leben“. —
Lies mir doch einmal zu Gefallen meine Schrift über Schopenhauer: es sind ein paar Seiten drin, aus denen der Schlüssel zu nehmen ist. Was diese Schrift und das Ideal darin betrifft — so habe ich bisher mein Wort gehalten.
Die hochmoralischen Attitüden mag ich schlechterdings nicht mehr. Die Worte in jener Schrift mußt Du ein wenig umfärben.
Nun stehe ich vor der Hauptsache. —
Was den Titel „fröhliche Wissenschaft“ betrifft, so habe ich nur an die gaya scienza der Troubadours gedacht — daher auch die Verschen.
Von Herzen
Dein alter Freund
Nietzsche.
Santa Margherita Ligure
poste restante.
Himmel! Was bin ich einsam!
346. An Heinrich Köselitz in Annaberg (Postkarte)
Vielleicht habe ich Ihre letzte Weisung, theurer Freund, falsch verstanden; ich habe einen Brief an Sie nach Annaberg abgehen lassen und nicht nach Leipzig. Noch nichts von Levi? Und wie steht es mit dem Gewandhause? Machen Sie doch ja Prof. Riedel und Fritzsch in meinem Namen einige Artigkeiten — es gieng so schnell mit dem Weggehn, und mancherlei lag einem auf dem Herzen. Hier war das Wetter auch zum Verzweifeln, wenigstens für meinen Kopf. Ich wohne in Rapallo, im albergo della Posta: und als der Einzige. Kommen Sie ja nach München hierher! — Briefe nach wie vor: Santa Marg<herita>, Lig<ure>; ferma in posta.
Ganz von Herzen Sie grüßend
Ihr F N.
347. An Lou von Salomé in Berlin (Entwurf)
M<eine> l<iebe> L<ou> nehmen Sie sich in Acht! Wenn ich Sie jetzt von mir weise, so ist dies eine fürchterliche Censur über Ihr ganzes Wesen! Sie haben mit einem der langmüthigsten und wohlmeinendsten M<enschen> zu thun gehabt: aber ich bin mehr als irgend ein M<ensch> glaubt durch Ekel zu überwältigen. Schreiben Sie mir andere Briefe. Besinnen Sie sich eines Bessern, besinnen Sie sich auf sich selbst!
Ich habe mich noch nie über einen M<enschen> getäuscht: und in ihnen ist jener Drang nach einer heiligen Selbstsucht, welche der Drang nach Gehorsam gegen das Höchste ist — Sie haben ihn ich weiß nicht durch welchen Fluch verwechselt mit seinem Gegensatze, dem Ausbeuten aus der ausbeutenden Lust der Katze um nichts als um des Lebens willen —
Wenn Sie allem Erbärmlichen in Ihrer Natur die Zügel schießen lassen: wer kann dann noch mit Ihnen umgehn!
Sie haben Schaden gethan, Sie haben Wehe gethan — und nicht nur mir sondern allen den M<enschen>, die mich liebten: — dies Schwert hängt über Ihnen
Sie haben in mir den besten Advokaten, aber auch den unerbittlichsten Richter! Ich will, daß Sie sich selbst verurtheilen, und sich Ihre Strafe bestimmen.
Dies Alles sind Dinge, die man hat, um sie zu überwinden — um sich zu überwinden.
Ja, ich war Ihnen böse: aber warum von dieser Einzelheit reden? Ich bin Ihnen alle 5 Tage böse gewesen — und glauben Sie mir ich habe immer einen sehr guten Grund dazu gehabt. Aber wie sollte ich jetzt mit M<enschen> leben können, wenn ich mein Abscheu vor vielem Menschlichen nicht zu überwinden wüßte?
Ich werde nicht nur durch Handl<ungen> sondern vielmehr durch Eigenschaften beleidigt.
ich hatte damals in Orta bei mir beschlossen, Sie zuerst mit meiner ganzen Ph<ilosophie> bekannt zu machen. Ach, Sie ahnen nicht, was das für ein Entschluß war: ich glaubte daß man kein größeres Geschenk Jemandem machen kann. Eine sehr langwierige Sache (Ein langwieriger Bau und Aufbau)
Damals war ich geneigt Sie für eine Vision und die Erscheinung meines Ideals auf Erden zu halten. Bemerken Sie: ich sehe sehr schlecht.
Ich glaube, es kann Niemand besser von Ihnen denken, aber auch Niemand schlimmer.
Hätte ich Sie geschaffen, so würde ich Ihnen gewiß eine bessere Gesundh<eit> gegeben haben, aber vor allem einiges Andre, an dem mehr liegt — und viell<eicht> auch ein Bischen mehr Liebe zu mir (obwohl daran gerade am allerwenigsten liegt) und es steht ganz so wie mit Freund R<ée> — ich kann weder mit Ihnen, noch mit ihm auch nur ein Wort von dem sprechen, was mir am meisten am Herzen liegt. Ich bilde mir ein, Sie wissen ganz und gar nicht, was ich will? — Aber diese erzwungene Lautlosigkeit ist mitunter fast zum Ersticken, namentlich wenn man den M. lieb hat
348. An Lou von Salomé in Berlin (Entwurf)
Ich glaube, es kann Niemand besser von Ihnen denken, aber auch Niemand schlimmer.
Es steht ganz so wie mit Freund R<ée> — ich kann weder mit Ihnen noch mit ihm ein Wort von dem sprechen, was mir am meisten am Herzen liegt. Diese erzwungene Lautlosigkeit ist mir mitunter fast zum Ersticken — namentlich weil ich Sie Beide lieb habe.
Damals war ich geneigt, Sie für eine Vision, und die Erscheinung meines Ideals auf Erden zu halten. Bemerkten Sie schon? ich sehe sehr schlecht.
Ja, ich war Ihnen böse! Aber warum von dieser Einzelheit reden? Ich bin Ihnen alle 5 Tage und öfter noch böse gewesen — und glauben Sie mir, ich habe meine sehr guten Gründe dazu gehabt. Ich werde mehr als durch Handlungen durch Eigenschaften beleidigt. Aber ich überwinde mich. Und wie sollte ich jetzt mit M<enschen> leben können, wenn ich meinen Abscheu vor vielem Menschlichen nicht zu überwinden wüßte. Ich habe die Welt und Lou nicht geschaffen. — Hätte ich L<ou> geschaffen, so würde ich Ihnen gewiß eine bessere Gesundheit gegeben haben, aber vor Allem einiges Andre, an dem viel mehr liegt als an Gesundheit — und vielleicht auch ein Bischen mehr Liebe zu mir (obwohl daran gerade am wenigsten liegt.)
(Ich habe mich im Ganzen Großen noch nie über einen M<enschen> getäuscht.)
Ich traute Ihnen höhere Gefühle als andern M<enschen> zu: das war, das allein, was mich so schnell an Sie band. Nach Allem, was mir von Ihnen erzählt worden war, war dies Zutrauen erlaubt. Ich würde Ihnen wehethun und nichts nützen, wenn ich Ihnen sagte, was ich meine heilige Selbstsucht nenne. — Seltsam! Ich glaubte im Grunde immer noch daran, daß Sie dieser höheren und allerseltensten Gefühle fähig sind: irgend ein Grund-Unglück in Ihrer Erziehung und Entwicklung hat Ihnen den guten Willen dafür nur zeitweilig gelähmt. — Denken Sie: jener Katzen-Egoismus der nicht mehr lieben kann, jenes Lebensgefühl im Nichts zu dem Sie sich bekennen sind genau das mir ganz Widerwärtige am Menschen: schlimmer als irgend etwas Böses. (Dinge, die man hat, um sie zu überwinden — um sich zu überwinden.): eingerechnet die Erkenntniß als plaisir neben andern plaisirs. Und wenn ich Sie irgendwie verstehe: dies Alles sind an Ihnen willkürliche und angezwungene Tendenzen — so weit es nicht Symptome Ihrer Krankheit sind (:worüber ich eine Menge schmerzlicher Hintergedanken habe.)
Damals in Orta hatte ich bei mir in Aussicht genommen, Sie Schritt für Schritt bis zur letzten Consequenz meiner Philosophie zu führen — Sie als den ersten Menschen, den ich dazu für tauglich hielt. Ach, Sie ahnen nicht, welcher Entschluß, welche Überwindung das für mich war! Ich habe als Lehrer immer viel für meine Schüler gethan: der Gedanke an Belohnung in irgend einem Sinn hat mich dabei immer beleidigt. Aber das, was ich hier thun wollte, jetzt, bei dem immer schlechteren Zustande meiner Körperkräfte, war über Alles Frühere hinaus. Ein langwieriger Bau und Aufbau! Ich habe nie daran gedacht, Sie erst um Ihren Willen zu fragen: Sie sollten kaum merken, wie Sie in diese Arbeit hineinkämen. Ich vertraute jenen höheren Impulsen, an welche ich bei Ihnen glaubte.
— ich dachte Sie mir als meinen Erben —
Was Freund R<ée> betrifft: so gieng es mir, wie es mir jedesmal (auch nach Genua) gegangen ist: ich kann dieses langsame Zugrundegehen einer außerordentlichen Natur nicht ansehen, ohne ingrimmig zu werden. Dieser Mangel an Ziel! und daher diese geringe Lust an den Mitteln, an der Arbeit, dieser Mangel an Fleiß, selbst an wissenschaftl. Gewissenhaftigkeit. Dieses fortwährende Vergeuden! Und wäre es wenigstens ein Vergeuden aus der Lust des Verschwendens! Aber es hat so ganz die Miene des schlechten Gewissens. — Ich sehe überall die Fehler der Erziehung. Ein Mann soll zum Soldaten erzogen werden, in irgend einem Sinne. Und das Weib zum Weib des Soldaten, in irgend einem Sinne
Spiritus und Portemonnaie.
349. An Paul Rée in Berlin (Entwurf)
Lieber Freund, ich nenne L<ou> meinen leibhaften Scirroco: noch nicht Eine Minute habe ich mit ihr zusammen jenen reinen Himmel über noch gehabt, den ich mit und ohne Menschen brauche. Sie vereinigt in sich alle Eigenschaften der M<enschen> die ich verabscheue — eklig und gräßlich — Sie bekommen mir nicht — und nun habe ich mir seit Tautenburg die Tortur aufgelegt sie zu lieben! Eine Liebe, deren wegen Niemand eifersüchtig zu sein hat höchstens vielleicht der liebe Gott.
Das ist so immer ein Problem für einen Tausendkünstler der Selbstüberwindung (so nannte mich R<ohde> jüngst)
350. An Lou von Salomé in Berlin (Entwurf)
Wenn m<eine> l<iebe> L<ou> all die Qual meiner Seele das Mittel sein sollte um Ihnen dieses Gefühl und diesen Brief zu entlocken, so will ich gern gelitten haben.
351. An Lou von Salomé in Berlin (Entwurf)
Ob ich Viel gelitten habe, das ist mir Alles nichts gegen die Frage: ob Sie sich selber wiederfinden, liebe Lou oder nicht — Ich bin noch nie mit einem so armen M<enschen> umgegangen wie Sie sind
unwissend — aber scharfsinnig
reich in der Ausnützung des Gewußten
ohne Geschmack, aber naiv in diesem Mangel
ehrlich und geradezu im Einzelnen, aus Trotz zumeist; im Ganzen, was die Gesammt-Haltung des Lebens betrifft unehrlich (krank aus Überarbeitung usw.)
Ohne jedes Feingefühl für Nehmen und Geben
ohne Gemüth und unfähig der Liebe
im Affekt immer krankhaft und dem Irrsinn nahe
ohne Dankbarkeit, ohne Scham gegen den Wohlthäter
untreu und jede Person im Verkehr mit jeder anderen preisgebend
unfähig der Höflichkeit des Herzens
abgeneigt gegen die Reinheit und Reinlichkeit der Seele
ohne Scham im Denken immer entblößt, gen sich selber gewaltsam im Einzelnen
unzuverlässig
nicht „brav“
grob in Ehrendingen
ungeheuer das Negative
„ein Gehirn mit einem Ansatz von Seele“
Charakter der Katze — das Raubthier, das sich als Hausthier stellt,
das Edle als Reminiscenz an den Umgang mit edleren M<enschen>
ein starker Wille, aber ohne großes Objekt
ohne Fleiß und Reinlichkeit
ohne bürgerliche Rechtschaffenheit
grausam versetzte Sinnlichkeit
rückständiger Kinder-Egoismus in Folge geschlechtlicher Verkümmerung und Verspätung
der Begeisterung fähig
ohne Liebe zu M<enschen>, doch Liebe zu Gott
Bedürfniß der Expansion
schlau und voll Selbstbeherrschung in Bezug auf die Sinnlichkeit der Männer
352. An Lou von Salomé vermutlich in Berlin (Entwurf)
Ich mache Ihnen heute nichts zum Vorwurf als daß Sie nicht zur rechten Zeit über sich gegen mich aufrichtig gewesen sind. Ich gab Ihnen in Luzern meine Schr<ift> über Sch<openhauer> — ich sagte Ihnen daß da meine Grundgesinnungen drin stünden und daß ich glaube, es würden auch die Ihrigen sein. Damals hätten Sie lesen und Nein! sagen sollen — In solchen Dingen hasse ich alle Oberflächlichkeit — es wäre mir Viel erspart geblieben! Ein solches Gedicht wie das „an den Schmerz“ ist in Ihrem Munde eine tiefe Unwahrheit. —
Sehen Sie, ich habe genau umgekehrt gehandelt: ich schrieb eigens dazu einen Brief an Fr<au> O<verbeck> um sie zu bitten, Ihnen über meinen Charakter einige (von mir bestimmt bezeichnete) Aufschlüsse zu geben, damit Sie nicht von mir erwarteten, was ich nicht gegen Sie leisten kann.
Ich habe das weiteste Herz für die Verschiedenheit von M<enschen>. Allein es ist unerträglich, Jemanden wegen Eigensch<aften> zu verehren deren Gegentheil er besitzt.
Sagen Sie nichts l<iebe> L<ou> zu Ihren Gunsten: ich habe schon mehr zu Ihren Gunsten geltend gemacht als Sie konnten — und zwar vor mir und vor Andern.
M<enschen> solcher Art wie Sie können nur durch ein hohes Ziel andern M<enschen> erträglich sein.
Wie verkümmert nimmt sich Ihre M<enschlichkeit> neben der von Freund R<ée> aus! Wie arm sind Sie in der Verehrung, der Dankbarkeit, der Pietät, der Höflichkeit, der Bewunderung — Scham — um von höheren Dingen nicht zu reden. Was würden Sie antworten wenn ich Sie fragte: sind Sie brav? Sind Sie unfähig des Verraths?
Haben Sie kein Gefühl davon, daß wenn ein M<ensch> wie ich in Ihrer Nähe ist, er viel Überwindung nöthig hat?
Ich könnte es mir leichter mit Ihnen machen: aber ich habe mich schon in so manchen Stücken überwunden, daß ich auch dies noch glaube, zu Stande zu bringen: Ihnen zu nützen, selbst wenn Sie mir schaden.
Wissen Sie daß ich Ihre Stimme nicht hören mag — außer wenn Sie bitten?
Sind Sie rechtschaffen? (Feingefühl im Verhältniß von Geben und Empfangen
353. An Paul Rée in Berlin (Entwurf)
ich habe gar nicht daran gezweifelt, daß sie irgendwann auf eine himmlische Weise sich von dem Schmutz jener schmählichen Handlungen reinigen wird.
Jeder andre Mann würde sich von einem solchen Mädchen mit Ekel weggewendet haben: auch ich hatte ihn, aber überwand ihn immer wieder und die Wahrheit zu sagen: es jammert mich eine edel angelegte Natur in ihrer Entartung zu sehn.
Diesen Streich spielte mir das Mitleid.
ich verlor das Wenige, was ich noch besaß, meinen guten Namen; das Vertrauen einiger M<enschen>, ich verliere viell<eicht> noch meinen Fr<eund> Rée — ich verlor das ganze Jahr durch die schrecklichen Qualen, denen ich bis heute ausgesetzt bin.
ich fand Niemanden in Deutsch<land> der mir hilft und bin jetzt von D<eutschland> wie verbannt und was mir am meisten weh thut — meine ganze Phil<osophie> ist bloßgestellt durch — — — vor mir selber brauche ich mich dieser ganzen Sache wahrlich nicht zu schämen: die stärkste und herzlichste Empfindung dieses Jahres habe ich für L<ou> gehabt, und es war nichts in dieser Liebe, was zur Erotik gehört. Höchstens hätte ich den l<ieben> G<ott> eifersüchtig machen können.
Seltsam! Ich dachte, es würde mir ein Engel entgegengeschickt, als ich mich wieder den M<enschen> und dem Leben zuwandte — ein Engel, der Manches in mir lindern sollte, was durch Schmerz und Einsamkeit zu hart in mir geworden war, und vor allem ein Engel des Muthes und der Hoffnung für Alles das was ich immer vor mir habe — Inzwischen war es kein Engel.
Im Übrigen will ich nichts mehr mit ihr zu thun haben. Es war eine vollkommen unnütze Verschwendung von Liebe und Herz. Nun, die Wahrheit zu sagen: ich bin reich genug dazu.
354. An Paul Rée in Berlin (Entwurf)
Ich verstehe Sie nicht mehr, l<ieber> F<reund> (wie können Sie es neben einem solchen Wesen aushalten! Um des Himmels Willen, reine Luft und gegenseitige höchste Achtung! Sonst — — —
355. An Lou von Salomé vermutlich in Berlin (Entwurf)
M<eine> l<iebe> L<ou> schreiben Sie mir doch nicht solche Briefe! Was habe ich mit diesen Armseligkeiten zu thun! Bemerken Sie doch: ich wünsche daß Sie sich vor mir erheben damit ich Sie nicht verachten muß.
Aber L<ou> was schreiben Sie denn für Briefe! So schreiben ja kleine rachsüchtige Schulmädchen. Was habe ich mit diesen Erbärmlichkeiten zu thun! Verstehen Sie doch: ich will, daß Sie sich vor mir erheben, nicht daß Sie sich noch verkleinern.
Wie kann ich Ihnen denn vergeben, wenn ich nicht erst das Wesen wieder an Ihnen entdecke, um dessentwillen Ihnen überhaupt vergeben werden kann!
Nein m<eine> l<iebe> L<ou> wir sind noch lange nicht beim „Verzeihen“. Ich kann das Verzeihen nicht aus den Ärmeln schütteln, nachdem die Kränkung 4 Monate Zeit hatte, in mich hineinzukriechen.
Adieu m<eine> l<iebe> L<ou> ich werde Sie nicht wiedersehen. Bewahren Sie Ihre Seele vor ähnl<ichen> Handl<ungen> und machen Sie an Andern und namentl<ich> an meinem Fr<eund> Rée gut, was Sie an mir nicht mehr gut machen können.
Ich habe die Welt und L<ou> nicht geschaffen: ich möchte, ich hätte es gethan — dann würde ich alle Schuld daran allein tragen können, daß es so zwischen uns gekommen ist.
Adieu l<iebe> L<ou> ich las Ihren Brief noch nicht zu Ende, aber ich las schon zuviel.
356. An Unbekannt (Entwurf)
Erst von dem Augenblick an, wo ich von Lou lasse, dürft ihr sie verachten — dann ist sie ein verächtliches Geschöpf — habe ich meinen Bek<annten> gesagt.
Es jammert mich Lou’s: sie hat auf jedes höhere Ziel und jedes Ideal verzichtet — es ist mir gräßlich und schwermüthig
357. An Malwida von Meysenbug in Rom (Entwurf)
Wie ging es doch zu? — Aber als ich Ihren Brief gelesen hatte, brach ich in Thränen aus. — Doch ich möchte heute nicht von mir sprechen.
Sie wollten wissen, wie ich über Frl Salomé denke.
M<eine> Schwester betrachtet L<ou> als ein giftiges Gewürm, welches man um jeden Preis vernichten müsse und handelt auch danach. Dies ist mir ein ganz übertriebener Gesichtspunkt und mir durchaus zuwider: im Gegentheil, ich möchte ihr von Herzen gern nützlich sein und ihr Bestes im jedem Sinn fördern. Ob ich das kann, ob ich es bisher gekonnt habe, ist eine Frage, auf die ich nicht antworten möchte: bemüht darum habe ich mich redlich. Für meine Interessen ist sie bis jetzt wenig zugänglich gewesen; und ich selber bin ihr (wie mir scheint) eher etwas überflüssig als interessant: das Zeichen eines guten Geschmacks!
Es ist Vieles an ihr anders als bei Ihnen — und auch bei mir: es drückt sich naiv aus und ist in dieser Naivetät für einen Menschen-Beobachter voller Reiz. Ihre Klugheit ist außerordentlich, und Rée meint, Lou und ich seien die klügsten Wesen — woraus Sie sehen daß R<ée> ein Schmeichler ist.
Ich bitte Sie aber aus ganzem Herzen Ihre Empfindung einer zärtlichen Theilnahme, welche Sie für Frl. S<alomé> gehabt haben, ihr zu erhalten — ja mehr zu thun. Aber worin dies mehr besteht, — darüber kann ich nicht schreiben.
Die Familie R<ée> nimmt sich in der angenehmsten Weise des jungen Mädchens an, und Paul ist auch hier wieder das Muster der Delikatesse und Fürsorglichkeit.
Meine Gesundheit erlaubt mir den Norden noch nicht, ja ich bin Europas müde, ich brauche ewig blauen Himmel, um das Leben zu ertragen.
„Der Tausendkünstler der Selbstüberwindung“ — so nannte mich kürzlich Rohde. An meinem Selbst gibt es schrecklich Viel zu überwinden.
Das Wort aus einer meiner Schriften, welches Sie citiren — ich kenne es nicht mehr —
Meine liebe verehrte Freundin, Sie erwarteten gewiß, etwas Anderes von mir zu hören. Und wenn ich Sie sehe, will ich anders reden. Aber schreiben? Nein.
358. An Malwida von Meysenbug in Rom (Fragment)
Meine liebe verehrte Freundin,
Wie gieng es doch zu? Aber als ich Ihren Brief gelesen hatte, brach ich in Thränen aus. — Doch ich wollte heute nicht von mir sprechen.
Sie wollten wissen, was ich über Fräulein Salomé denke? — Meine Schwester betrachtet Lou als ein giftiges Gewürm, welches man um jeden Preis vernichten müßte — und handelt auch darnach. Das ist mir nun ein ganz übertriebener Gesichtspunkt und meinem Herzen durchaus zuwider. Im Gegentheil: ich möchte nichts mehr als ihr nützlich und förderlich sein, im höchsten und im bescheidensten Sinne des Worts. Ob ich das kann, ob ich’s bisher gekonnt habe, ist freilich eine Frage, auf die ich nicht antworten möchte: bemüht darum habe ich mich redlich. Für meine „Interessen“ ist sie bis jetzt wenig zugänglich gewesen; ich selber bin ihr (wie mir scheint) eher etwas überflüssig als interessant: das Zeichen eines guten Geschmacks! Es ist Vieles an Ihr anders als bei Ihnen — und auch bei mir; es drückt sich naiv aus und ist in dieser Naivetät für den Menschen-Beobachter voller Reiz. Ihre Klugheit ist außerordentlich: Rée meint, Lou und ich seien die klügsten Wesen — woraus Sie sehen, daß Rée ein Schmeichler ist.
Die Familie Rée nimmt sich auf die angenehmste Weise des jungen Mädchens an; und Paul R<ée> ist auch hier wieder das Muster der Delicatesse und Fürsorglichkeit.
Meine liebe verehrte Freundin, vielleicht wollten Sie etwas Anderes von mir über L<ou> hören: und wenn ich Sie wiedersehen werde, sollen Sie auch Anderes von mir hören. Aber schreiben? Nein. —
Aber ich bitte Sie aus ganzem Herzen, die Empfindung einer zärtlichen Theilnahme, welche Sie für L<ou> gehabt haben, ihr zu bewahren — ja, mehr zu thun! Aber worin dies <mehr besteht,> darüber kann ich <nicht schreiben.>
[ + + + ] Einsame Menschen leiden fürchterlich an Erinnerungen.
Beunruhigen Sie sich nicht — im Grunde bin ich Soldat und sogar eine Art „Tausendkünstler der Selbst-Überwindung“. (So nannte mich kürzlich Freund Rohde, zu meinem Erstaunen)
Liebe Freundin, giebt es denn nicht irgend einen Menschen auf der Welt, der mich liebt? — —
[+ + +]
359. An Franz Overbeck in Basel
Lieber Freund, herzlichen Dank für Deine Nachrichten! Es geht etwas besser, oder vielmehr: es wird schon besser gehn! Viele Anfälle hinter mir. Es ist fast zum Lachen: ich habe jetzt 3 Jahre hinter einander fast um die gleiche Zeit an mein „Ende aller Dinge“ geglaubt! Indessen: ich bin zäh, und auch in anderm Betrachte habe ich genug Härte gegen mich noch vorräthig, um dem Leben noch etwas zuzusehn, selbst wenn es mich maltraitirt.
Trotzalledem muß ich in dem nächsten Jahre etwas in Hinsicht auf meine Zukunft erfinden und mich mir selber etwas mehr sicher stellen. Mit aller meiner „Vernunft“ bleibe ich ein leidenschaftliches und plötzliches Wesen; die Einsamkeit ist, je länger je mehr, etwas Gefährliches. —
Ich gieng dies Jahr mit einem wirklichen Verlangen zu „den Menschen“ zurück — ich meinte, man dürfe mir schon etwas Liebe und Ehre erweisen. Ich erlebte Verachtung, Verdächtigung und, in Hinsicht auf das, was ich kann und will, eine ironische Gleichgültigkeit. Durch einige böse Zufälle erlebte ich dies Alles in der grausamsten Form. — Objektiv betrachtet: es war höchst interessant. —
Nun stehe ich ganz einsam vor meiner Aufgabe und weiß auch, was mich nach deren Lösung erwarten wird. Ich brauche ein Bollwerk gegen das Unerträglichste. — —
Denke Dir: ich habe einen neuen Anhänger — nämlich Hans von Bülow („hingebende Theilnahme für mich“). Auch ein Brief des Dr. H. von Stein überraschte mich — er ist ganz stumm geworden durch „die fröhliche Wissenschaft“ und sendet mir einen „ehrfurchtsvollen Gruß“.
Da fällt mir ein, daß ich so gerne Deine liebe Frau noch über den Sanctus Januarius hören möchte.
Bizet war ein großer Genuß, ich wünschte um mich herum etwas Bizetismus in allerlei Gestalt. Ich habe die Idylle nöthig — zur Gesundheit.
Mit dem herzlichsten Gruße
(Santa Margarita Ligure, poste restante.)
Dein Freund F N.
360. An Paul Rée und Lou von Salomé in Berlin (Entwurf)
Ich bin, um als Freigeist zu reden in der Schule der Affekte d. h. die Affekte fressen mich auf. Ein gräßliches Mitleid, eine gräßliche Enttäuschung, ein gräßliches Gefühl verletzten Stolzes — wie halte ich’s noch aus? Ist nicht Mitleid ein Gefühl aus der Hölle? Was soll ich thun? An jedem Morgen verzweifle ich, wie ich den Tag überdaure. Ich schlafe nicht mehr: was hilft es 8 Stunden zu marschiren! Woher habe ich diese heftigen Affekte! Ach etwas Eis! Aber wo giebt es für mich noch Eis! Heute Abend werde ich so viel Opium nehmen, daß ich die Vernunft verliere: Wo ist noch ein M<ensch> den man verehren könnte! Aber ich kenne Euch Alle durch und durch.
Beunruhigen Sie sich nicht zu sehr über die Ausbrüche meines Gräßenwahns oder meiner verletzten Eitelkeit: und wenn ich selbst aus den genannten Affekten mir zufällig einmal das Leben nehmen sollte, so würde auch dann nicht gar zu viel zu betrauern sein. Was gehn Euch ich meine Sie und Lou, meine Phantastereien an! Erwägen Sie Beide doch sehr miteinander, daß ich zuletzt ein kopfleidender Halb-Irrenhäusler bin, den die Einsamkeit vollends verwirrt hat. — Zu dieser, wie ich meine verständigen Einsicht in die Lage der Dinge komme ich, nachdem ich eine ungeheure Dosis Opium aus Verzweiflung eingenommen habe. Statt aber den Verstand dadurch zu verlieren, scheint er mir endlich zu kommen. Übrigens war ich wirklich wochenlang krank: und wenn ich sage, daß ich hier 20 Tage Orta-Wetter gehabt habe wird Ihnen mein Zustand begreiflicher erscheinen. Bitten Sie Lou, mir Alles zu verzeihen — sie giebt auch mir noch eine Gelegenheit, ihr zu verzeihen. Denn bis jetzt habe ich ihr noch nichts verziehen. Man vergibt seinen Freunden viel schwerer als seinen Feinden.
Da fällt mir Lou’s Vertheidigung ein. Seltsam! So oft sich Jemand vor mir vertheidigt, läuft es immer darauf hinaus, daß ich Unrecht haben soll. Dies weiß ich nun schon im Voraus, und so interessirt’s mich nicht mehr.
Sollte Lou ein verkannter Engel sein? Sollte ich ein verkannter Esel sein?
in opio veritas: Es lebe der Wein und die Liebe!
Machen Sie sich doch keine Skrupel! Ich bin’s ja so gewöhnt: in diesem Jahre werden sich Alle an mir ärgern, im nächsten vielleicht alle an mir freuen.
361. An Lou von Salomé und Paul Rée in Berlin (Fragment)
Meine Lieben, Lou und Rée!
Beunruhigt Euch nicht zu sehr über die Ausbrüche meines „Größenwahns“ oder meiner „verletzten Eitelkeit“ — und wenn ich selbst aus irgend einem Affekte mir zufällig einmal das Leben nehmen sollte, so würde auch da nicht allzuviel zu betrauern sein. Was gehen Euch meine Phantastereien an! (Selbst meine „Wahrheiten“ giengen Euch bisher nichts an) Erwägen Sie Beide doch sehr miteinander, daß ich zuletzt ein kopfleidender Halb-Irrenhäusler bin, den die lange Einsamkeit vollends verwirrt hat.
Zu dieser, wie ich meine, verständigen Einsicht in die Lage der Dinge komme ich, nachdem ich eine ungeheure Dosis Opium — aus Verzweiflung — eingenommen habe. Statt aber den Verstand dadurch zu verlieren, scheint er mir endlich zu kommen. übrigens war ich wirklich wochenlang krank; und wenn ich sage, daß ich hier 20 Tage Orta-Wetter gehabt habe, so brauche ich nichts mehr zu sagen.
Freund Rée, bitten Sie Lou, mir Alles zu verzeihen — sie giebt auch mir noch eine Gelegenheit, ihr zu verzeihen. Denn bis jetzt habe ich ihr noch nichts verziehn.
Man vergiebt seinen Freunden viel schwerer als seinen Feinden.
Da fällt mir Lou’s „Vertheidigung“ [ + + + ]
362. An Paul Rée in Stibbe (Entwurf)
Ich schreibe dies bei hellstem Wetter: verwechseln Sie nicht meine Vernunft mit dem Unsinn meines neulichen Opiumbriefes. Ich bin durchaus nicht verrückt und leide auch nicht an Größenwahn. Aber ich sollte Freunde haben, die mich vor solchen verzweifelten Dingen, wie denen des Sommers zur rechten Zeit warnten.
Wer konnte ahnen, daß ihre Worte Heroismus „kämpfen für ein Prinzip“ ihr Gedicht „an den Schmerz“ ihre Erzählungen von den Kämpfen für die Erkenntniß einfach Betrügerei sind? (Ihre Mutter schrieb mir in diesem Sommer: L<ou> hat die denkbar größte Freiheit gehabt.)
Oder steht es anders? Die Lou in Orta war ein anderes Wesen, als die, welche ich später wiederfand. Ein Wesen ohne Ideale, ohne Ziele, ohne Pflichten, ohne Scham. Und auf der tiefsten Stufe des M<enschen>, trotz ihrem guten Kopf!
Sie sagte mir selber, sie habe keine Moral — und ich meinte, sie habe gleich mir eine strengere als irgend Jemand! und sie bringe ihr öfter täglich und stündlich Etwas von sich zum Opfer.
Einstweilen sehe ich nur, daß sie auf Belustigung und Unterhaltung aus ist: und wenn ich denke, daß dazu auch die Fragen der Moral gehören, so ergreift mich, gelinde gesagt, eine Empörung. Sie hat es mir sehr übel genommen, daß ich ihr das Recht auf das Wort „Heroism der Erkenntniß“ absprach — aber sie sollte ehrlich sein und sagen: „ich bin himmelweit gerade davon entfernt.“ Beim Heroism handelt es sich um die Aufopferung und die Pflicht und zwar die tägliche und stündliche, und demnach um viel mehr: die ganze Seele muß voll von Einer Sache sein, und Leben und Glück gleichgiltig dagegen. Eine solche Natur glaubte ich in L<ou> zu sehn.
Hören Sie, Freund, wie ich heute die Sache ansehe! Sie ist ein vollkommenes Unglück — und ich bin das Opfer desselben.
Ich habe im Frühling gemeint, es habe sich ein M<ensch> gefunden, der im Stande sei, mir zu helfen: wozu freilich nicht nur ein guter Intell<ekt> sondern eine Moralität ersten Ranges noth thut. Statt dessen haben wir ein Wesen entdeckt, welches sich amüsiren will und schamlos genug ist, zu glauben, daß dazu die ausgezeichnetsten Geister der Erde eben gut genug sind.
Das Resultat dieser Verwechslung ist für mich, daß ich mehr als je der Mittel entbehre, einen solchen M<enschen> zu finden und daß meine Seele, die frei war, von einer Fülle widerlicher Erinnerungen gemartert wird. Denn die ganze Würde meiner Lebens-Aufgabe ist durch <ein> oberflächliches und unmoralisches leichtfertiges und gemüthloses Geschöpf wie Lou in Frage gestellt worden und auch daß mein Name
mein Ruf ist befleckt
Ich habe geglaubt, Sie hätten sie überredet, mir zu Hülfe zu kommen.
an P<aul> R<ée>
363. An Franziska und Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Entwurf)
Du mußt über einen andern Ton nachdenken mit mir zu reden: sonst nehme ich keine Briefe mehr aus Naumburg an!
Ich bringe es schlechterdings, nicht mehr über mich, einen Brief aus Naumb<urg> zu öffnen; und immer weniger sehe ich ein, wie Ihr das wieder gut machen wollt, was Ihr mir diesen Sommer angethan habt und dessen Nachwirkungen mich fortwährend treffen.
364. An Franz Overbeck in Basel (Entwurf)
L<ieber> F<reund> Dieser Bissen Leben war der härteste den ich bisher kaute; es ist immer noch möglich, daß ich daran ersticke. Ich habe an den beschimpfenden und qualvollen Erlebnissen dieses Sommers gelitten wie an einem Wahnsinn. Die ganze Zeit brachte ich es viell<eicht> zu 4, 5 Nächten Schlafs — und auch das nur mit den stärksten Dosen an Schlafmitteln. Mein ganzes Denken Dichten und Trachten ist von den Verheerungen dieser Affekte heimgesucht. Was soll draus werden! Ich spanne jede Faser von Selbstüberwindung an —aber — es ist zu viel für einen M<enschen> so langer Einsamkeit
Heute unterwegs fiel mir etwas ein, das mich sehr lachen machte: sie hat mich nämlich behandelt wie einen Studenten von 20 Jahren — eine für ein Mädchen von 20 Jahren sehr erlaubte Denkungsweise — einen Studenten der sich in sie verliebt hatte. Aber Weise wie ich lieben nur Gespenster — und wehe wenn ich einen M<enschen> liebte — ich würde ba<ld> an dieser Liebe zu Grunde gehen. Der M<ensch> ist eine zu unvollkommene Sache
365. An Franz Overbeck in Basel
Lieber Freund
vielleicht hast Du meinen letzten Brief gar nicht bekommen? — Dieser letzte Bissen Leben war der härteste, den ich bisher kaute und es ist immer noch möglich, daß ich daran ersticke. Ich habe an den beschimpfenden und qualvollen Erinnerungen dieses Sommers gelitten wie an einem Wahnsinn — meine Andeutungen in Basel und in meinem letzten Briefe verschwiegen immer das Wesentlichste. Es ist ein Zwiespalt entgegengesetzter Affekte darin, dem ich nicht gewachsen bin. Das heißt: ich spanne alle Fasern meiner Selbst-Überwindung an — aber ich habe zu lange in der Einsamkeit gelebt und an meinem „eigenen Fette“ gezehrt, daß ich nun auch mehr als ein Anderer von dem Rade der eignen Affekte gerädert werde. Könnte ich nur schlafen! — aber die stärksten Dosen meiner Schlafmittel helfen mir eben so wenig als meine 6—8 Stunden Marschiren.
Wenn ich nicht das Alchemisten-Kunststück erfinde, auch aus diesem — Kothe Gold zu machen, so bin ich verloren. — Ich habe da die allerschönste Gelegenheit zu beweisen, daß mir „alle Erlebnisse nützlich, alle Tage heilig und alle Menschen göttlich“ sind!!!!
Alle Menschen göttlich. —
Mein Mißtrauen ist jetzt sehr groß: ich fühle aus Allem, was ich höre, Verachtung gegen mich heraus. — Z. B. noch zuletzt aus einem Briefe von Rohde. Ich will doch darauf schwören, daß er, ohne den Zufall früherer freundschaftl. Beziehungen, jetzt in der schnödesten Weise über mich und meine Ziele aburtheilen würde.
Gestern habe ich nun auch mit meiner Mutter den brieflichen Verkehr abgebrochen: es war nicht mehr zum Aushalten, und es wäre besser gewesen, ich hätte es längst nicht mehr ausgehalten. Wie weit inzwischen die feindseligen Urtheile meiner Angehörigen um sich gegriffen haben und mir den Ruf verderben — — nun, ich möchte es immer noch lieber wissen als an dieser Ungewißheit leiden. —
Mein Verhältniß zu Lou liegt in den letzten schmerzhaftesten Zügen: so glaube ich heute wenigstens. Später, — wenn es ein Später giebt, will ich auch darüber ein Wort sagen. Mitleid, mein lieber Freund, ist eine Art Hölle — was auch die Anhänger Schopenhauers sagen mögen.
Ich frage Dich nicht: „was soll ich machen?“ Einige Male dachte ich daran, mir in Basel ein Stübchen zu miethen, Euch hier und da <zu> besuchen und Vorlesungen zu hören. Einige Male dachte ich auch an’s Gegentheil: meine Einsamkeit und Entsagung auf ihren letzten Punkt zu treiben und —
Nun, das laufe nun seinen Weg! Lieber Freund, Du mit Deiner verehrungswürdigen und klugen Frau — Ihr seid mir beinahe noch der letzte Fußbreit sicheren Grundes. Seltsam!
Mäge es Euch gut gehen!
Dein F. N.
366. An Franz Overbeck in Basel
Lieber Freund
Dank von ganzem Herzen für Deine zwei Briefe. Und heute wirst Du Dich nicht wundern zu hören, daß ich inzwischen auch noch nicht weise geworden bin. Die ungeheure Spannung, mit der ich die letzten 10 Jahre Schmerz und Entsagung überwunden habe, rächt sich in solchen Zuständen; ich bin zu sehr Maschine dadurch geworden, und die Gefahr ist nicht gering, bei so heftigen Bewegungen, daß die Feder springt.
Ich war drei Mal in Genua, aber fand kein Zimmer, wie ich es diesmal brauche, nämlich mit Ofen. Es ist kalt, ich habe in Leipzig schon mich an Feuer gewöhnt — und zuletzt: ich habe nicht viel Wärme zuzusetzen. In Genua giebt es keine Öfen. Der kälteste Monat ist gerade vor der Thür.
Zuletzt hilft es nichts, ich muß hier bleiben. Für meinen Kopf bietet die Nähe des Meeres eine Erleichterung — das ist nicht zu unterschätzen, da ich, wie begreiflich, jetzt wieder sehr viel auch physisch zu leiden habe.
Ich bin nun einmal nicht Geist und nicht Körper, sondern etwas drittes. Ich leide immer am Ganzen und im Ganzen. —
Nun, was soll werden? Meine Selbst-Überwindung ist im Grunde meine stärkste Kraft: ich dachte neulich einmal über mein Leben nach und fand, daß ich gar nichts weiter bisher gethan habe. Selbst meine „Leistungen“ (und namentlich die seit 1876) gehören unter den Gesichtspunkt der Askese. Askese sieht natürlich bei diesem Menschen etwas anders aus als bei dem andern. (Auch der Sanctus Januarius ist das Buch eines Asketen — meine liebe Frau Professor Overbeck!)
Mit herzlichem Gruße
Dein F.N.
Und Heil dem neuen Jahre — um nichts über das alte zu sagen!
Sylvester 1882 (mich schaudert bei dieser Jahreszahl.)
1882 (183 Briefe)
185. An Heinrich Köselitz in Venedig
Здесь, дорогой друг, приходит Кармен: но в наказание за вашу морализаторскую проповедь о «благах счастья» она будет принадлежать вам только до нашей следующей встречи! — Клавир, который я вчера прочитал, французски скуден, в нём не хватает всех добавок! Однако вокальные партии полные — и вы, конечно, всё угадаете! Я позволил себе сделать несколько заметок на полях — в уверенности в вашей гуманности и музыкальности. В итоге, возможно, я даю вам прекрасную возможность посмеяться надо мной — Кармен действительно была в эту зиму одним из моих «благ счастья», и Генуя стала для меня намного дороже благодаря этой опере. — Ваше письмо имело небесно-венецианский цвет, я счастлив от обещания сочетаться с Венецией не только в тайном браке.
Ф.Н.
186. An Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Моя дорогая сестра, твои стихи вдохновлены лучшим тактом — тактом с пяти сторон: и для всего, что имеет 5 сторон, у твоего братика такие хорошие глазки. В первом стихотворении я бы предложил изменить: „ибо там должен каждый спрашивать“, а во втором везде нужно сделать правильные гекзаметры
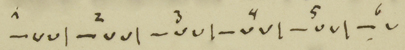
Вместо двух кратких слогов может стоять и долгий, кроме пятого стопы. — По поводу 2 февраля я совершенно согласен. —
Шмейцнер, вероятно, больше не имеет переплетных обложек, а все отправил в Байрейт: и в Байрейт я не хотел бы писать — я отказался читать эти листы, и там это знают. Мой годовой взнос в 20 марок я продолжаю платить — кажется ли тебе это уместным? — Сколько томов? Тебе и нашей дорогой матери самые прекрасные благодарности за добрые рождественские письма и новогодние пожелания. Я снова болел.
187. An Heinrich Köselitz in Venedig
Какую радость доставил мне ваш письмо! Как вы меня успокоили насчет меня самого! — Такое одинокое существо подвержено всем опасностям заблуждений вкуса; ну, если я теперь и заблудился, то вместе с вами! —
Я хотел бы писать вам каждый день, но трудолюбие или болезнь (поочередно) распоряжаются моими глазными силами. Выдержу ли я это?
Погода такая, что я каждый день начинаю и заканчиваю вопросом: «была ли когда-нибудь такая хорошая погода?» — словно создана для моей натуры, свежая, чистая, мягкая.
Новый год принес «письмо с поклоном» из Америки, от имени 3 лиц (среди них профессор Института Пибоди в Балтиморе) — Я так близок к вам, час за часом!
Ф.Н.
188. An Ida Overbeck in Basel
Моя дорогая и уважаемая госпожа профессор, если я к Вашему письму, которое придало моему Новому году праздничный блеск, добавлю последний полученный американский письмо, то должен сказать: я обязан двум женщинам самым красноречивым выражением того, что мои мысли действительно также обдумываются и рассматриваются, а не просто читаются (или точнее: „а не просто не читаются!“). То письмо пришло от супруги профессора Института Пибоди в Балтиморе; которая от имени своего мужа и друга благодарит меня, как и Вы, благодарите меня, обдуманным образом! Ну, это исключения, и я наслаждаюсь ими как исключениями; правило было до сих пор: никакого эффекта или бездумный эффект!Вы поверите мне, что я поэтому не думаю о людях плохо и что из всех гримас мне кажется самой смешной гримаса «непризнанного гения». Очень медленный и долгий путь будет уделом моих мыслей — да, я верю, чтобы выразиться немного кощунственно, в мою жизнь только после смерти и в мою смерть во время жизни. И это справедливо и естественно! —
Когда я снова увижу вас, я расскажу вам некоторые любопытные подробности — сегодня только слово о возможностях этого «когда-я-снова-увижу-вас». Я связан в Генуе работой, которая может быть завершена здесь, только здесь, потому что она имеет генуэзский характер — ну, почему я не должен вам этого сказать?
Это моя „Утренняя заря“, рассчитанная на 10 глав, а не только на 5; и многое из того, что содержится в первой половине, является лишь основой и подготовкой к чему-то более тяжёлому, более высокому (да! придётся ещё сказать кое-что „ужасное“, дорогая госпожа профессор!) Короче, я не знаю, смогу ли я летом лететь на север: но если я поеду, то приеду через Базель и к вам домой.
В Байройте на этот раз я буду „блистать“ своим отсутствием — если только Вагнер не пригласит меня лично (что, по моим понятиям о „высшей пристойности“, было бы вполне уместно!) Моё право на место я оставлю в полной спячке.По правде говоря: я бы предпочёл услышать «Шутку, хитрость и месть», чем «Парсифаля».
Чтобы вы знали, что происходит между господином Кёзелицем и мной, и как я продолжаю «портить молодёжь» (— чаша с цикутой, вероятно, мне не миновать!), я прилагаю последнее письмо господина Кёзелица: оно, возможно, вызовет у вас некоторое «удивление», но, конечно, не «ужас»!
Погода последних месяцев была такой, что я не мог бы противопоставить ей ничего более прекрасного и благотворного из всей моей жизни — свежая, чистая, мягкая: сколько часов я пролежал у моря! Сколько раз я наблюдал закат!
Дорогая госпожа профессор, «всё хорошее общее между друзьями» — говорят греки: пусть жизнь подарит нам ещё много общего! — так я думал, когда читал ваше письмо.
От всего сердца благодарный и преданный
Д-р Ф. Ницше.
189. An Heinrich Köselitz in Venedig
Дорогой друг, я только что придумал письмо к придворному капельмейстеру Леви в Мюнхене, который был мне известен ранее — но в конце концов я должен все же сначала попросить у вас разрешения на этот шаг. Возможно, я сам мог бы написать письмо королю (используя «случай», что я отправил ему свою «Утреннюю зарю»!) Я готов ко всему и даже больше с тех пор, как получил ваше письмо. Должен ли я написать Бюлову? Дайте мне быстрый знак, и я сделаю это. Будет ли ваша поездка на север означать прекращение вашего венецианского существования? И когда вы поедете? —
Я сразу ответил на открытку Герсдорфа (Лейпциг, Линденштрассе, 10) и ожидал, что Герсдорф напишет немедленно, судя по характеру этого письма. Но прошел месяц без письма. Что произошло? —
Я написал позавчера госпоже Овербек, что я гораздо охотнее послушал бы «Шутку, хитрость и месть», чем Парсифаля. Но «философ» так бесполезен для своих друзей! —
190. An Heinrich Köselitz in Venedig
Ну, мой дорогой друг, я пишу вам несколько строк — охотнее всего я был бы сейчас с вами. Действительно, вы были в опасности быть удивлённым мной — только известие от моих родственников, что давно анонсированный визит доктора Рée близок, удержало меня здесь, в Генуе. То, что вы сейчас переживаете, это правило — я был прошлым летом так удивлён, так вне себя от удивления, что дела в отношении вас и вашей оценки должны были однажды пойти иначе и исключительно.
Но я хотел бы помочь вам немного преодолеть эту проклятую «регулярность» или — чтобы сказать правду — позволить вам помочь мне преодолеть её; ибо я не только разозлился на этот венский отказ, но и обиделся, да, буквально заболел и стал неспособен на все хорошее стало. Мне это прозвучало как насмешливый протест против моего только что записанного на бумаге мирного образа мышления и «покорности Богу». Лучшее противоядие теперь: посмеяться вместе и сделать хорошую музыку. Я не могу вам сказать, как сильно мне хочется вашего matr<imonio> segr<eto>.
В тот день, вечером которого пришло ваше письмо, я размышлял о том, что все ближайшие планы относительно моего пребывания и все распределение этого и следующего года зависят от музыки господина Петера Гаста и от судьбы этой музыки, — я обдумывал зиму в Вене и Венеции. Воистину, дорогой друг, так удивительно мало хорошего приходит ко мне извне, я в своем одиночестве как бы засыпан снегом и живу так, немного слишком покинутый и слишком мертво оцененный, даже своими друзьями.
Только вы и ваше будущее — включая Навсикаю — только ваши письма и мысли являются прекрасным исключением в моей «зиме», и, вероятно, тем, что приносит и сохраняет мне больше всего тепла.
Несколько слов о моей «литературе». Я закончил книги VI, VII и VIII «Утренней зари» несколько дней назад, и на этом моя работа на этот раз завершена. Ведь книги 9 и 10 я оставлю на следующую зиму — я еще не достаточно зрел для элементарных мыслей, которые я хочу изложить в этих заключительных книгах. Среди них есть мысль, которой действительно нужны «тысячелетия», чтобы стать чем-то.
Откуда беру я смелость, чтобы выразить это!Сегодня я читал, впервые с прошлого лета, что-то в своей „Утренней заре“ и получил от этого удовольствие. Учитывая, что эти вещи очень абстрактны, живость ума, с которой они изложены, вполне достойна. Прочтите для сравнения какую-нибудь книгу о морали — у меня всё ещё остаются свои прыжки и „Хопсаса“ для себя. Кроме того, меня привлекло, как богата книга невысказанными мыслями, по крайней мере для меня: я вижу здесь и там и на всех концах скрытые двери, которые ведут дальше и часто очень далеко (и не только на „отхожие места“ — простите!)
Хотите мою новую рукопись? Возможно, она доставит вам удовольствие и развлечение. (Только не думайте о переписывании — на это ещё есть год времени, а может быть, и гораздо больше)
Мне пришло в голову, что я должен сам ещё раз прочитать рукопись, чтобы вы могли её прочитать (не хватает многих знаков и даже некоторых слов). Учитывая, что здоровье и глаза подводят меня, я, вероятно, не справлюсь с этой корректурой и проверкой раньше, чем через 2 недели.
Этот январь — самый прекрасный в моей жизни. Но в нём было только 21 день! —
От всего сердца ваш друг Ф. Н.
191. An Heinrich Köselitz in Venedig
Дорогой друг, г-н фон Бюлов обладает недостатками прусских офицеров, но он «честный малый» — то, что он больше не хочет иметь дела с немецкой оперной музыкой, имеет тайные причины всякого рода; мне приходит на ум, что он однажды сказал мне: «Я не знаю новой музыки Вагнера». — Летом поезжайте в Байрейт, там вы найдете всех театральных людей Германии вместе, а также князя Лихтенштейна и т.д., Леви тоже. Я думаю, что все мои друзья будут там, включая мою сестру, согласно её вчерашнему письму (и это мне очень приятно!).
Будь я с вами, я познакомил бы вас с сатирами и посланиями Горация — я имею в виду, для этого мы оба как раз созрели. Когда я сегодня заглянул в них, я нашел все обороты очаровательными, как теплый зимний день.
Мое последнее письмо было для вас слишком «фривольным», не так ли? Будьте терпеливы! Что касается моих «мыслей», мне все равно, есть ли они у меня; но избавиться от них, когда я хочу от них избавиться, становится для меня всегда чертовски сложно! —
О, какое время! О, эти чудеса прекрасного января! Будьте в хорошем настроении, дорогой друг!
192. An Franz Overbeck in Basel
Мой дорогой друг, вчера моя сестра написала мне, что она хотела бы воспользоваться моим «правом» на место в Байрейте: ну, если не слишком поздно, хорошо, я подпишу формуляр, о котором ты мне писал, — ведь от квитанций у меня ничего не осталось. — Впрочем, мне приятно слышать о таком решении моей сестры; я думаю, что все мои друзья будут там, включая господина Кёзелица. Я же сам стоял слишком близко к Вагнеру, чтобы появиться там простым гостем праздника без некоего «восстановления» (κατάστασις πάντων — церковный термин). Однако на такое восстановление, которое, разумеется, должно было бы исходить от самого Вагнера, нет надежды; и я даже не желаю его.Наши жизненные задачи различны; личные отношения при такой разнице были бы возможны и приятны только в том случае, если бы Вагнер был гораздо более деликатным человеком. Я думаю, дорогой друг, ты понимаешь меня в этом. Это уже возникшее отчуждение имеет свои преимущества, которые я не так легко, ради художественного наслаждения или из чистой «добродушности», снова отдам. Конечно: я теряю единственную возможность снова увидеть всех, кто мне близок или был близок, и снова укрепить многие пошатнувшиеся отношения. Вот друг Роде, который не уделил мне ни слова с тех пор, как я отправил «Утреннюю зарю», совсем как фрейлейн фон Мейзенбуг и так далее.
Теперь, когда ты там с твоей дорогой женой, прошу тебя, скажи обо мне доброе слово тому и этому. Я действительно не стал «нечеловеком»! —
Вчера я отправил новую рукопись господину Кёселицу в Венецию. Не хватает ещё 9-й и 10-й книг, которые я сейчас не могу сделать — для этого нужны свежие силы и глубокое одиночество (доктор Рее приезжает на следующей неделе). Возможно, я найду месяц этим летом, который даст мне и то, и другое, в каком-нибудь лесу: я думал о лесах Корсики, но и о Чёрном лесе (Санкт-Блазиен?). Возможно, однако, мне придётся подождать с этой самой трудной из всех моих задач до зимы.
Тем временем есть плохие новости от господина Кёселица.
Венцы вернули ему партитуру; попытка заинтересовать Бюлова своим произведением также не удалась (он больше не хочет иметь ничего общего с немецкой оперной музыкой). — Я безмерно благодарен за всё, что могло бы звучать для нашего бедного друга в этой тяжёлой ситуации как ободрение и утешение. — Впрочем, он философ, больше, чем я. Честно говоря, я сам переношу его неудачу тяжелее, чем он! —Мой дорогой друг, сколько я тебе всегда доставляю хлопот и забот! — Когда мы снова встретимся, окажешь ли ты мне честь прочитать свой доклад о возникновении христианской литературы? — У вас тоже такой «весенний» сезон, как у нас? Истинные «чудеса святого Януария!» —
От всего сердца твой и ваш
Фридрих Ницше
193. An Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Да, как же мне сразу ответить тебе, моя любимая сестра? Дело в том, что я ещё не разобрался с твоим подарком — пишущей машинкой; когда я снова тебя увижу, у меня будет что сказать, что я не смог бы написать. —
Что касается места в Байройте, которое, конечно, полностью в твоём распоряжении, я сразу написал Овербеку. Надеюсь, что не слишком поздно. Мне очень приятно, что ты хочешь там быть; ты найдёшь там всех моих друзей. Я же — прости! — точно не приеду, если только В<агнер> лично не пригласит меня и не отнесётся ко мне как к самому почётному из своих гостей. (Мне, пожалуй, нужно установить для себя некоторую „этикетку“). — Вчера я отправил новое М<ану>с<крипт> г-ну Кёселицу (продолжение „Утренней зари“). Но в этом году оно не будет напечатано! —
От всего сердца благодарен
Ф.
194. An Franziska Nietzsche in Naumburg
Моя дорогая мать, так летят годы, один быстрее другого. В конце концов, выучиваешь игру жизни наизусть — получаешь её, как говорят пианисты, «в пальцы»; поэтому всё идёт так быстро! Я это уже замечаю: насколько же больше заметишь ты! И так же, как и мне, тебе в день рождения не нужны будут пожелания; удерживать то, что имеешь, — главное искусство поздней жизни, и знать, что у тебя впереди больше, чем у многих, и особенно у всех недовольных! Год делает тебе весёлое лицо: постараемся и мы дать тебе повод для радости и благополучия в жизни! Как этот прекраснейший из январских дней!
—Здесь всегда как весной: можно сидеть на открытом воздухе уже утром, и при этом в тени — не замерзая. Нет ветра, нет облаков, нет дождя! Один старик сказал мне, что в Генуе еще никогда не было такой зимы. Море спокойное и сильно опустилось. Персики цветут! — Если, конечно, будет после-зима, то с оливковыми деревьями и всеми фруктами будет хуже, чем когда-либо! — Я вижу солдат в самом легком льняном одеянии; я сам на своих прогулках ношу те же одежды, что и в летний день в Энгадине, с чьими хорошими днями нынешняя погода родственна.
Но, конечно: погода, которая мне вредит, во время моего последнего пребывания там наверху была настолько преобладающей, и всё в целом было таким испытанием терпения, что в этом году я запрещаю себе Энгадин. —
Несмотря на эту погоду, моё самочувствие было очень переменчивым; и мне должно было быть намного лучше, если бы я не должен был также работать этой зимой. И регулярная умственная работа день за днём в определённые часы всё ещё остаётся самым верным средством незаметно свести меня в могилу. «Незаметно» — это значит, наступает день, когда я замечаю, что дело обстоит очень плохо, и когда восстановление уже нельзя добиться за несколько дней отдыха.
Ко всему этому с октября я страдаю от сильных зубных болей — есть около 6 полых зубов, и слово «зубные операции» наполняет меня завистью. Возможно, мне всё-таки придётся решиться поехать во Флоренцию к доктору ван Мартеру, который уже однажды имел меня в своих руках. — Недавно я познакомился с другой болезнью, которая имеет свои неудобства; теперь меня мучает болезнь мочевого пузыря и не хочет отступать. Короче, ты видишь, что мне ещё многое приходится терпеть, и мне нужна большая сила духа, которую не так просто купить на ближайшем рынке.
Вот! Больше я не могу писать сегодня, глаза уже болят. — — С большим нетерпением жду приезда доктора.
Рэ — он как раз прибудет на карнавал, который на этот раз предлагает выступление знаменитой француженки Сары Бернар. У нас будет 3 дня (5, 6 и 7 февраля) французского театра в нашем большом театре Карло-Феличе, который вмещает 3000 человек — и он будет полон. —
Ещё раз, моя дорогая добрая мама, я постараюсь, чтобы в этом твоём новом году у тебя не было из-за меня новых забот — со старыми придётся смириться! —
От всего сердца твой сын
Фридрих.
Не так ли, я узнаю точное время прибытия моего друга, чтобы я мог быть на вокзале? Он хочет остаться здесь на месяц, и мне нужно снять жильё? — Salita delle Battistine 8, interno 6 — это адрес.
195. An Heinrich Köselitz in Venedig
Мой дорогой друг, я нахожу Ваше обращение с делом Бюлова совершенно уместным — я думаю, сам Бюлов найдет его уместным; он способен на либеральные порывы. — Вчера приехал доктор Рее; он живет в соседнем доме и останется на месяц. Сегодня вечером мы оба будем сидеть вместе в театре Карло Феличе, чтобы восхищаться Сарой Бернар в роли дамы с камелиями (Дюма-сын). Пишущая машинка (вещь за 500 франков) здесь, но — с дорожной поломкой: возможно, ее снова придется отправить на ремонт в Копенгаген, сегодня я получу от первого местного механика информацию об этом. —
Герсдорф считает, что постановка «Шутка, Любовь и Месть» возможна в Лейпциге — рассказывает Рее.
— Неррина восприняла помолвку ГКак? Вы в конце концов не едете в Байройт? — При этой возможности я испытываю слишком разные чувства одновременно, чтобы сказать, как это на меня действует. Но мне кажется, это не полезно — и хотя бы потому, что вам следовало бы познакомиться с оркестром Вагнера и его оркестровыми изобретениями. В конце концов: я очень хотел бы увидеть вас среди всех моих друзей, которые, как я себе представляю, постараются загладить перед вами то, что у них на «дорогом сердце» по отношению ко мне — Простите, что заговорил об этом!
«Чувство причинности» — да, друг, это нечто иное, чем тот «априорный понятийный» о котором я говорю (или болтаю!) Откуда берется безусловная вера в всеобщность и всеприменимость этого чувства причинности? Такие люди, как Спенсер, считают, что это расширение на основе бесчисленных опытов, накопленных многими поколениями, в конечном итоге абсолютная индукция. Я же думаю, что эта вера — остаток более древней и гораздо более узкой веры. Но к чему это!Я не могу писать о таком, мой дорогой друг, и должен отослать вас к «9-й книге» «Утренней зари», чтобы вы увидели, что я меньше всего отклоняюсь от мыслей, которые ваше письмо мне излагает: — я радовался этим мыслям и нашему единодушию.
Новый «Журнал» меня совсем не неприятно удивил. Или я ошибаюсь? Разве эта основная мысль его введения — европейство с перспективой уничтожения национальностей — не моя мысль? Скажите мне правду: возможно, какое-то зеркальное фехтование тщеславия сбивает меня с толку.—
Недавно я гулял и не думал ни о чём, кроме музыки моего друга Густава Круга, — совершенно случайно и без всякого повода. На следующий день ко мне попадает тетрадь с его песнями (изданная Кантом), и среди них как раз та песня, которую я реконструировал во время своей прогулки. Самая удивительная игра случая!
Погода по-прежнему, неописуемая! Вчера Рée и я были в том месте на побережье, где мне через сто лет (или 500, или 1000, как вы любезно предполагаете!) поставят колонну в честь «Утренней зари». Мы лежали весело, как два морских ежа, на солнце.
С самыми сердечными приветствиями, ваш преданный сосед по душе
Ф.Ницше.
196. An Franziska und Elisabeth Nietzsche in Naumburg
Только одно словечко сегодня, мои дорогие! Это было настоящее Рождество, которое обрушилось на меня, и к тому же настоящий Дед Мороз, хотя отнюдь не ворчун! Теперь давайте попробуем всё: прекрасные меховые лапки и такие желанные для моей едва раскрытой птичьей натуры, хотя и слишком гордые записные книжечки. (Одна из прежних чёрных заполнена, другую чёрную я сегодня подарил другу Рée —: так что на этот год у меня для использования есть две книжечки: искусство, удовольствие, животное и гений.) Послезавтра больше, сегодня только самый сердечный привет и благодарность!
Ф.
197. An Franziska und Elisabeth Nietzsche in Naumburg
Вот сначала реверс для Байройта, который теперь, по указанию Овербека, должен продолжить свой путь к Фойстелю в Б<айройт>, и при этом с явным указанием с твоей стороны, моя дорогая сестра, на какой из 3 дней главного представления ты решилась (26, 28 или 30 июля). Тогда он отправит тебе билет.
До сих пор всё шло, как и следовало ожидать, не хорошо. Первый день очень хороший; второй я пережил, используя все укрепляющие средства; третий — истощение, днём обморок; ночью приступ; четвёртый — в постели; пятый — я снова встал, чтобы снова лечь днём, шестой и до сих пор — головная боль и слабость.
Короче, нам ещё нужно научиться быть вместе. Просто слишком приятно общаться с доктором Рэ; трудно найти более освежающее общение. Но я не привык к хорошему. —Ему это нравится или, скорее: он очень удивлён, как сильно ему здесь нравится. —
С Сарой Бернар мы потерпели неудачу. Мы были на первом представлении; после первого акта она упала как мёртвая. После мучительного часа ожидания она продолжила играть, но в середине третьего акта её настиг кровотечение, на сцене — и всё закончилось.
Это было невыносимое впечатление, особенно потому, что она как раз играла больную такого рода (дама с камелиями Дюма-сына) — Тем не менее, она снова играла с огромным успехом на следующий и послеследующий вечера и убедила Геную, что она „первая живая артистка“. — Она очень напомнила мне, внешностью и манерами, госпожу Вагнер. — В середине марта доктор Рее едет в Рим к фрейлейн фон Мейзенбуг. — С пишущей машинкой еще ничего не решено; чрезвычайно умелый механик работал над ней неделю, чтобы ее сделать. Завтра она должна быть „готова“. Надеемся на лучшее!
Как я был одарен вами, мои дорогие! И я также слышу от доктора Р<е> только радостные вести о вас. Я думаю, что наша дорогая Лизбет сейчас или очень скоро сможет быть полезной госпоже Рее; она уезжает в воскресенье.
Больше здоровье совершенно не позволяет писать. Простите!
С самой большой благодарностью
Ваш Фр.
Какой адрес и титул Густава Круга?
198. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Друг Рее и я — да как часто мы говорим о вас и беспокоимся и надеемся вместе по поводу всего, что касается господина Петера Гаста! Как мы желаем вас сюда! — ибо теперь у меня есть ещё одна вероятность, что Генуя вам понравится: Рее вне себя от удивления, как сильно она ему нравится. Впрочем, он обещает вам, что в следующем году на карнавале в Венеции будет, при условии, что вы будете «причастны» — и я тоже хочу там быть. —
Герсдорф сказал в Лейпциге о вас: «что Карлсбад для испорченного желудка, то Кёзелиц для испорченного духа».
Пишущая машинка здесь, но сильно повреждена — её уже неделю «чинят».
С нашим сердечным приветом Р. и Н.
199. An Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Ура! Машина только что переехала в мою квартиру; она снова работает идеально. — Я ещё не знаю, сколько стоил ремонт. Друг Р<ée> не захотел мне этого сказать.
Ф.
200. An Franz Overbeck in Basel (Postkarte)
Мой дорогой друг, постоянные приступы мешали мне до сих пор поблагодарить тебя за твое письмо и сообщить, что я отправил байрейтскую расписку по твоему указанию моей сестре: она, вероятно, сделает все остальное. — Доктор Рее со мной; он приехал через Верону, очень сожалея, что Базель не лежал на его пути. Трудно найти более приятное и внимательное общение, чем его со мной, и мы часто бываем веселы до безудержности; он очень удивлен, как сильно ему нравится Генуя. — Тем не менее, я снова понимаю, что абсолютное одиночество для меня не прихоть, а сама разумность. — Он останется до середины марта. (Я недавно писал фрау Ротплец, как и раньше твоей дорогой жене: письма дошли?)
Твой Ф.
201. An Heinrich Köselitz in Venedig (Typoskript)
Гладкий лёд — рай
Для того, кто умеет танцевать.
Не хочешь утомить глаз и разум
Беги и за светом в тени
Не будь слишком щедрым! только собаки
гадят каждый час.
Лучше враждовать из цельного дерева
Чем дружить на клею.
Необходимость дешева: счастье бесценно,
Потому сижу я не на золоте, а на своей заднице.
Как лучше всего взобраться на гору?
Просто поднимайся и не думай об этом.
И ржавчина нужна: быть острым — недостаточно:
Иначе всегда скажут о тебе: «он слишком молод».
Ф.Н.
202. An Heinrich Köselitz in Venedig (Typoskript)
Дорогой друг, Ваша похвала моим стихам очень удивила меня. Я развлекаюсь подобным на своих прогулках. Себастьяна Бранта я не знаю. Вы правы — наши письменные принадлежности работают вместе с нашими мыслями. Когда же я смогу заставить свои пальцы выдавить длинное предложение! —
Впрочем, несмотря на самое освежающее общество, я почти всегда как полумёртвый. Мы трижды купались в море. На следующей неделе мы едем на два дня в Монако. В середине марта друг покидает меня, чтобы переехать в Рим. Генуя нравится ему больше, чем Сорренто и Неаполь. Вы, возможно, слышали, вернулись ли Вагнеры из Палермо или хотят ли они встретить Пасху в Риме? Я слушал ради вас "Севильского цирюльника". Это было образцовое исполнение, всё первого ранга, как мне показалось, даже дирижёр. Но музыка мне не понравилась. Я люблю совсем другой Севилью. Не могли бы вы придумать для меня какое-нибудь большое развлечение? Я хотел бы провести несколько лет в приключениях, чтобы дать своим мыслям время, тишину и свежую землю. — — — — —
Ваш друг Ницше.
Чёрт! Вы это тоже читаете?!
203. An Franziska und Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Typoskript)
Мои дорогие, я мог бы сообщить вам столько же радостного, сколько приходит от вас. Но я всегда как полумёртвый, и последний приступ был одним из самых тяжёлых. Во всех перерывах, как и между всем этим горем, мы много смеёмся и говорим о хорошем и плохом. Возможно, я сопровожу друга в поездке на Ривьеру. Пусть она ему понравится так же, как Генуя: я здесь очень как дома. Маркиза Дориа спрашивала у меня, не хочу ли я давать ей уроки немецкого: я сказал нет. Пишущая машинка сначала более агрессивна, чем любое другое письмо. Во время большого карнавального шествия мы были на кладбище, самом красивом из самых красивых на земле. В середине марта Рée едет к фрейлен фон Мейзенбуг в Рим. Мы оба предпочитаем Геную Соррентской местности. Трижды мы купались в море. С самым сердечным благодарением и приветом
Ваш Ф.
204. An Franz Overbeck in Basel (Typoskript)
Это письмо, мой дорогой друг, одновременно и упражнение для пальцев — прости и прими как есть! В середине марта мой друг Рее покидает меня, чтобы навестить фрейлейн фон Мейзенбуг в Риме. Я сам остаюсь здесь только до конца того же месяца. Мне уже сейчас здесь слишком светло. Но куда? — Да, кто бы мог мне это сказать! Не сочти за труд снова прислать мне обычные 500 франков? Партитура Кёселица теперь в руках барона Лёна: Герсдорф помог в этом. Свадьба последнего состоится 19 марта. Он написал мне очень откровенно и смело, как будто из новой тональности. Ромундт закончил новую книжечку — «Христианство и разум» —: «Ты должен был бы стать пастором!» — говорит Герсдорф, который нарисовал к ней виньетку. Моя сестра некоторое время провела с женой Рее и была от неё в восторге. Также она слушала лекцию доктора Фёрстера в Доме архитекторов (Берлин), который дважды упоминал меня в преувеличенных выражениях. Он хочет эмигрировать в Южную Бразилию, если только — —
С сердечной дружбой и приветом от доктора Рее.
Твой Ф. Н.
205. An Heinrich Köselitz in Venedig (Typoskript)
Дорогой друг, это были бы приключения по моему вкусу: если бы только моё здоровье было по моему вкусу! Я охотно повёл бы колонию в высокогорья Мексики: или отправился бы с Ре в пальмовую оазу Бискра — ещё лучше мне бы подошла война. Больше всего мне понравилось бы принуждение к самой малой доле в великом самопожертвовании. Здоровье говорит "нет" всему. Мы провели два дня в Монако, я, разумеется, без игры. Однако провести вечер в этих залах — это самый приятный вид общения. Люди там для меня так же интересны, как золото безразлично. — Сколько бы я отдал за то, чтобы думать о музыке "Севильского цирюльника" так же, как и вы: в конце концов, это тоже вопрос здоровья. Музыка должна быть очень страстной или очень чувственной, чтобы мне понравиться. Этой музыке не хватает и того, и другого: её невероятная гибкость даже неприятна мне, как вид клоуна. — Не исключено, что в конце марта я приеду в Венецию: или там есть смутьяны? Я прошу вас поделиться со мной частью вашей смелости и настойчивости. — Ре чтит и любит вас так же, как и я.
Ваш друг Н.
206. An Franziska und Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Typoskript)
Мои дорогие, с нашей поездкой в Монако нам повезло — я не играл, а Рée по крайней мере не проиграл. Это место — рай ада в плане расположения, природы, искусства и людей. Лучшим для меня было спокойное чаепитие в великолепном чайном салоне, где нас обслуживал напомаженный и пестрый слуга с отличным чаем. Весь этот берег невероятно дорогой, как будто деньги не имеют ценности. Ментона была выбрана Герсдорфом для его свадебного путешествия. Свадьба состоится 19 марта. Дайте мне совет по поводу свадебного подарка! Вагнеры были единственными, кто не поздравил его с помолвкой. Моему здоровью этот сезон не благоприятствует. Во время последних приступов я изверг невероятное количество желчи. Эта машина снова была в ремонте.
С сердечной любовью и очень благодарен за ваши прекрасные письма
Ваш Ф.
207. An Gustav Krug in Köln (Typoskript)
Дорогой друг! С твоими песнями произошло со мной нечто странное. Однажды прекрасным днём я вспомнил всю твою музыку и музыкальность — и в конце концов спросил себя: почему он никогда ничего не печатает? При этом в ушах у меня звучала одна строка из молодого Никласа. На следующее утро друг Рее прибыл в Геную и принес мне твою первую тетрадь — и когда я ее открыл, мне сразу бросился в глаза молодой Никлас. Вот это была бы история для господ спиритуалистов! —
Твоя музыка обладает достоинствами, которые ныне редки —: я смотрю теперь на всю новую музыку с точки зрения все возрастающего упадка мелодического чувства. Мелодия, как последнее и возвышеннейшее искусство искусства, имеет законы логики, которые наши анархисты хотели бы заклеймить как рабство —: я уверен только в том, что они не могут дотянуться до этих самых сладких и зрелых плодов. Я рекомендую всем композиторам прелестнейшее из аскетических упражнений: на время считать гармонию не изобретенной и собирать коллекции чистых мелодий, например, из Бетховена и Шопена. — В твоей музыке звучит много хорошего прошлого, и, как ты видишь, также что-то от будущего. Я благодарю тебя от всего сердца.
Твой друг Ф.Н.
208. An Heinrich Köselitz in Venedig (Typoskript)
Дорогой друг — Рée зачитал мне ваш трактат, и, как и я, он снова удивлён тем, что теперь возможно для музыканта. Этот грубый смысл фактов, эта энергия захвата, эта склонность к миру контрапункта художника — откуда у вас всё это? Возможно, от вашего отца: но, конечно, не от ваших учителей и меньше всего от меня —: я гораздо более скептичен и фантастичен, чем вы, и всё больше понимаю, что судьба подарила мне в вас бесценное средство воспитания. Даже ваша нынешняя «упорность» действует на меня благотворно: да, и я хочу закончить, несмотря на моё проклятое здоровье, как вы хотите закончить, несмотря на Лёэна «отца лжи». Так его называет Герсдорф, который написал мне добродушное письмо. В конце месяца я отправляюсь «на край света»: да, если бы вы знали, где это! Вы бы в конце концов пришли за мной? — Я бы хотел вернуть своё рукопись перед отъездом — пожалуйста, пожалуйста! Дорогой друг, да здравствует свобода, веселье и безответственность! Давайте жить выше себя, чтобы жить с собой!
Верный вам Ф. Н.
209. An Heinrich Köselitz in Venedig (Typoskript)
Мой дорогой бедный друг, вот песенка для нашего развлечения: она нам обоим так необходима. Теперь, когда вы начинаете страдать от самого себя, зло достигло своего пика. Теперь нужно: sauve qui peut! Невыносимо видеть, как вы гибнете у меня на глазах —: проявите же хоть немного сострадания ко мне! В конце концов, я поступил так же глупо и безрассудно, как и вы: наши буржуазные добродетели и предрассудки — наши главные опасности — например, этот бесчеловечный труд. Хотите узнать мое состояние?
В наказание за безумную деятельность моих первых базельских лет я теперь не могу выполнить даже малейшую умственную работу без укола совести —: каждый раз я чувствую: «это неверно, ты не должен больше работать!» Ваши слова относительно глаз причинили мне больше боли, чем что-либо за последние годы. Оставьте эту партитуру, сейчас и немедленно! Вся задача вашей жизни встает перед вами и говорит: «Так велит долг»! Следующие месяцы должны быть полностью посвящены выздоровлению: тело и душа просят и умоляют вас об этом — и я тоже! Сколько денег вам нужно на три месяца в горах? Они в вашем распоряжении. Будьте великодушны ко мне — к себе! В верности
Ваш друг
Ф.N.
Песня о маленькой брига "Ангелочек".
Ангелочек: так зовут меня —
Теперь корабль, когда-то девочка
Ах, всё ещё очень девочка:
Ибо крутится вокруг любви
Всегда мой тонкий рулевой.
Ангелочек: так зовут меня —
Украшена сотней флажков,
И самый прекрасный капитан
Раздувает мой руль:
Как сотый флажок.
Ангелочек: так зовут меня —
Куда бы ни горело пламя
Для меня, бегу, как ягнёнок,
Свой путь тоскующе:
Всегда была таким ягнёнком:
Ангелочек: так зовут меня —
Верьте ли, что как собачка
Лаять могу и что мой ротик
Пышет паром и огнём?
Ах, дьявола мой ротик:
Ангелочек: так зовут меня —
Сказала однажды горькое словцо
Так, что быстро к последнему местечку
Мой любимый друг убежал:
Да, он умер от этого словца.
Ангелочек: так зовут меня —
Едва услышала, прыгнула с утёска
В глубину и сломала рёбрышко.
Чтобы душа моя ушла:
Да, она ушла через это рёбрышко.
Ангелочек: так зовут меня —
Моя душа, как кошечка,
Сделала раз, два, три, четыре, пять шажков,
Затем взлетела в этот кораблик:
Да, у неё проворные лапки.
E
Ангелочек: так меня зовут —
Сейчас корабль, когда-то девочка:
Ах, всё ещё очень девочка:
Ведь крутится вокруг любви
Всегда мой тонкий рулевой.
Ангелочек: так меня зовут.
210. An Franz Overbeck in Basel (Typoskript)
Дорогой друг, вероятно, твоя денежная посылка уже на местной почте: мне сообщили о прибытии рекомендованного письма. Сегодня я прошу тебя отправить оставшиеся 250 франков господину Кёселицу — с пометкой, что они от меня. Весна позади: у нас летнее тепло и летняя яркость. Это время моего отчаяния. Куда? куда? куда? Мне так не хочется покидать море. Я боюсь гор и всего внутреннего — но я должен уехать. Какие приступы я снова пережил! Огромные количества желчи, которые я теперь постоянно извергаю, вызывают мой интерес. Отчет "Берлинского дневника" о моей генуэзской жизни развеселил меня — даже пишущая машинка не была забыта.Эта машина нежна, как маленькая собака, и доставляет много хлопот — и некоторое развлечение. Теперь мои друзья должны изобрести для меня машину для чтения вслух: иначе я отстану от самого себя и не смогу больше достаточно питаться духовно. Или, вернее, мне нужен молодой человек рядом со мной, который был бы достаточно умен и образован, чтобы работать со мной вместе. Даже двухлетний брак я заключил бы для этой цели — хотя в этом случае, конечно, пришлось бы учесть несколько других условий. — Роде написал —: я не думаю, что образ, который он себе обо мне создал, правильный; но я не слишком недоволен тем, что этот образ не еще более ложный. Но он не способен чему-то у меня научиться — у него нет сочувствия к моей страсти и страданиям. — В Берлине у меня есть странный апостол: представь, что доктор Б. Фёрстер в своих публичных лекциях представляет меня своим слушателям в очень восторженных выражениях. — Рее сейчас в Риме: в конце апреля он едет в Швейцарию к своей матери. Он очень радуется дню в Базеле и заранее шлет привет.
Прощай, мой дорогой друг — я всегда твой и ваш преданный и благодарный
Ф.Н.
211. An Franz Overbeck in Basel (Postkarte)
Кёселиц не хочет денег. — О, он такой упрямый! — 500 франков у меня в руках: благодарю тебя, мой дорогой друг. —
Спешу Твой
Ф. Н.
212. An Elise Fincke in Baltimore (Typoskript)
Да, уважаемая госпожа, есть ещё кое-что из моих сочинений, что можно прочесть — более того: вам ещё предстоит прочесть всё, что я написал. Те "несвоевременные размышления" я считаю юношескими работами: там я подводил предварительный итог тому, что больше всего мешало и помогало мне в жизни до того момента, там я пытался избавиться от некоторых вещей, унижая или возвеличивая их, как это свойственно молодости —: Ах, благодарность в добре и зле всегда доставляла мне много хлопот! Впрочем — благодаря этим первым работам я завоевал некоторое доверие, в том числе и у вас, и у ваших выдающихся товарищей по учёбе! Все это доверие вам понадобится, чтобы следовать за мной по моим новым и небезопасным путям и, наконец — кто знает? кто знает? — и вы не выдержите и скажете то, что уже говорили многие: пусть бежит, куда ему угодно, и ломает себе шею, если ему угодно.
Ну что ж, уважаемая госпожа, теперь вы хотя бы предупреждены?
Вы удивляетесь, что я пишу так поздно — я почти ослеп, и только с тех пор, как у меня есть эта пишущая машинка, я снова могу отвечать на письма, то есть в течение трёх недель. Мой адрес — Генуя. —
Ваш преданный слуга
Д-р Ф. Ницше.
213. An Heinrich Köselitz in Venedig (Typoskript)
Мой дорогой друг! Пусть всё будет так, как вы желаете, чтобы я верил, что это так: — Уф! Это можно было бы лучше сказать по-латыни и в семи словах. — Подумайте, не хотите ли вы продать мне и двум моим друзьям вашу партитуру «Matrimonio»? Я предлагаю 6000 франков, выплачиваемых в четырех годовых взносах по 1500 франков. Дело может остаться в тайне, если вы этого желаете — своему отцу вы можете сказать, что издатель предложил вам эту сумму. — Затем подумайте, что нужно сделать, чтобы компенсировать «нечестие» против их классика Чимарозы в глазах итальянцев. Следовало бы рекомендовать и настойчиво советовать произведение королевы Маргариты и извлечь выгоду из политической ситуации. Немецкая вежливость по отношению к Италии — так это должно выглядеть.
Для этой цели первая постановка, конечно, могла бы быть только в Риме: посвящение королевы должно быть очень интересно и желательно для господина фон Койделла. Предположим, эта мысль вам понравится — тогда я советую наконец привлечь фрейлейн Эмму Неваду для этого произведения: она только что завоевала Рим. Итальянцы очень любезны со всеми знаменитыми певицами. Но страстной я видел их только один раз.
Сейчас у нас здесь Первая венская опереточная труппа — то есть немецкий театр. Благодаря ей я получил очень ясное представление о том, какой должна быть ваша Скапина. В плане женской безудержности и грации венские дамы, кажется, действительно изобретательны.
Вам для этого произведения из-за его бедного действия нужны только первые сюжеты. Мне противна идеалистически приличная посредственность исполнения. — Вот! Это значит болтать как театральный директор — Простите!Я читал у Р<оберта> Майера: друг, это большой специалист — и не более. Я удивлен, как грубо и наивно он рассуждает во всех общих вопросах: он всегда считает себя чудом логичным, если только упрям. Если что-то хорошо опровергнуто, так это предрассудок о «материи»: и притом не идеалистом, а математиком — Бошковичем. Он и Коперник — два величайших противника очевидности: с тех пор больше нет материи, разве что как популярное упрощение.Он довел атомистическую теорию до конца. Тяжесть — это, конечно, не «свойство материи», просто потому, что нет никакой материи. Сила тяжести, как и vis inertiae, конечно, является формой проявления силы (просто потому, что нет ничего, кроме силы!): только логическое отношение этой формы проявления к другим, например, к теплу, все еще совершенно неясно. — Предположим, однако, что вы, как и М<айер>, все еще верите в материю и в наполненные атомы, то тогда нельзя декретировать: «есть только одна сила». Кинетическая теория должна признавать за атомами, помимо кинетической энергии, еще две силы — когезии и тяжести. Это делают все материалистические физики и химики! и лучшие последователи М<айера> сами. Никто не отказался от силы тяжести! — В конце концов, у М<айера> есть еще вторая сила в основе, перводвигатель, милый Бог, — наряду с самим движением. Ему он тоже совершенно необходим!
Живите хорошо или, скорее, хорошо, мой дорогой друг!
С верностью Ваш Ф. Н.
214. An Malwida von Meysenbug in Rom (Typoskript)
Моя глубокоуважаемая фрейлейн, на самом деле мы уже простились друг с другом — и именно мое уважение к таким последним словам заставило меня так долго молчать перед Вами. Тем временем жизненная сила и всякого рода силы были активны во мне: и так я живу второй жизнью и с восторгом слышу, что Вы никогда не теряли веру в такую вторую жизнь во мне. Я прошу Вас сегодня жить еще долго, долго: так Вы сможете испытать радость и от меня. Но я не должен ничего ускорять — дуга, по которой проходит моя траектория, велика, и я должен жить и думать основательно и энергично на каждом ее участке: я должен еще долго, долго оставаться молодым, хотя уже приближаюсь к сорока. — Что теперь весь мир оставляет меня в одиночестве, на это я не жалуюсь — я нахожу это, во-первых, полезным, а во-вторых, естественным. Так было и всегда будет правилом. Даже поведение Вагнера по отношению ко мне подчиняется этой банальности правила. Кроме того, он человек своей партии; и случай его жизни дал ему такое случайное и неполное образование, что он не может понять ни тяжести, ни необходимости моего рода страсти.
Мысль о том, что Вагнер когда-то мог поверить, что я разделяю его взгляды, теперь заставляет меня краснеть. В конце концов, если я не совсем ошибаюсь насчёт своего будущего, лучшая часть влияния Вагнера будет жить в моём влиянии — и это почти смешно в этом деле. - - -
Пришлите мне, пожалуйста, Ваш очерк о Пьеве-ди-Кадоре: я охотно следую Вашим следам. Два года назад я как раз с тоской смотрел на это место. — Не верьте тому, что говорит обо мне друг Рее — у него слишком хорошее мнение обо мне — или, вернее: я жертва его идеалистического порыва. —
Преданный Вам от всего сердца и всё ещё старый, хотя и новый
Фридрих Ницше.
215. An Paul Rée in Rom (Typoskript)
Мой дорогой друг, какое удовольствие доставляют мне ваши письма! — Они отвлекают меня — во всех направлениях, и в конечном итоге при любых обстоятельствах тянут меня к вам! — Вчера я купался в море, именно в том знаменитом месте, где — подумайте, прошлым летом один из моих ближайших родственников был застигнут таким приступом в воде и, так как случайно никого не было поблизости, утонул. О ваших 30 франках я очень смеялся — почта вручила мне это письмо, не потребовав даже мой паспорт — и молодой чиновник передаёт вам привет — ecco! — Овербек прислал мне мои деньги — теперь я обеспечен на пару месяцев. — Передайте привет этой русской от меня, если это имеет какой-то смысл: я алчу душ такого рода.
Да, я скоро отправлюсь на поиски — учитывая то, что я планирую сделать в следующие 10 лет, они мне необходимы. Совсем другая тема — брак — я мог бы согласиться разве что на двухлетний брак, и то только в свете того, что я собираюсь делать в следующие 10 лет. — Исходя из опыта, который я только что получил с Кёзелицем, мы никогда не заставим его принять от нас деньги — разве что в самой буржуазной форме покупки и продажи. Вчера я написал ему, не хочет ли он продать мне и двум моим друзьям партитуру "Матримонио" —: я предложил ему 6000 франков, выплачиваемых в четыре годах по 1500 франков. Это предложение я считаю тонким и коварным —. Как только он скажет "да", я сообщу вам; и тогда вы будете так добры, чтобы поговорить с Герсдорфом. —Прощайте! Пишущая машинка больше не работает, как раз на месте заклеенной ленты.
Я написал фрейлейн фон Мейзенбуг также по поводу Пьеве.
Мои сердечнейшие пожелания вашего благополучия, днем и ночью
Ваш преданный друг Ф. Н.
Я отправляю письмо фрейлейн фон Мейзенбуг Rom poste restante, так как у меня нет её адреса.
Нет! Я отправляю письмо фрейлейн фон М. на ваш адрес, дорогой друг.
216. An Paul Rée in Rom (Postkarte)
Дорогой друг, деньги пришли — но вы не вспомнили о курсе салиты Баттестине, о котором мы договаривались, и прислали мне на 20 лир больше! — Пишущая машинка отказала со вчерашнего дня; совершенно загадочно! Всё в порядке! но ни одной буквы не разобрать. — Несколько скверных дней! Ах, эта проклятая облачная электричество! Должен ли я действительно быть настолько безумен, чтобы снова приближаться к горам? У моря мне всё же легче всего. Но где же морское место, где достаточно тени для меня! è una miseria!
Сердечно приветствующий Ф. Н.
217. An Heinrich Köselitz in Venedig (Typoskript)
Мой дорогой друг, я видел мадемуазель Неваду только в роли снамбулы: её другие оперы — «Миньон», «Севильский цирюльник», «Фауст». Но певица Кармен была мадам Галли-Марие, une personne très jolie, très chic. — Своим предложением я хотел бы хотя бы с одной стороны противостоять опасности переутомления — первая часть суммы к вашим услугам, когда пожелаете. Таким образом, желаемая вами независимость от родственников будет достигнута немного раньше, или хотя бы начнёт осуществляться. Конечно, та же сумма готова к вашим услугам и без «купли-продажи» — будьте же непринуждённы в этом вопросе, как и Ричард Вагнер, который и сейчас остаётся таковым: и правильно делает. Моё предложение о покупке — лишь уступка вашим буржуазным предрассудкам. Вы же не будете на меня за это сердиться? — В середине следующей недели я уезжаю: у вас будет по крайней мере два месяца покоя впереди меня. Слава Богу, — скажете вы.
Верный вам
Ваш друг Ницше.
218. An Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Моя дорогая сестра, вот небольшой подарок на день рождения, немного раньше времени — но я собираюсь уезжать и должен воспользоваться моментом. Я знакомлю тебя здесь с превосходной женщиной, которая заслуживает нашего почитания не только как мать фрау Козимы Вагнер. — Проклятое письмо! Но пишущая машинка с моей последней открытки стала непригодной; погода пасмурная и облачная, а значит, влажная: от этого каждый раз лента тоже становится влажной и липкой, так что каждая буква залипает, и текст совсем не виден. Вообще!!! - - - Я напишу, как только у меня будет постоянное летнее жилище: но, возможно, это займет немного больше времени!
Твой и Ваш Ф.
219. An Franziska und Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Ваше удовольствие от моих стихов доставило мне большое удовольствие; вы знаете, поэты безудержно тщеславны. Несколько мудрых рифм в старом немецком стиле произвели на Кёзелица наибольший эффект удивления. Наконец, если глаза мешают мне что-то учить — я скоро дойду до этого! — я всегда могу ковать стихи. — Последний приступ моей болезни полностью походил на морскую болезнь: когда я проснулся к существованию, я лежал в красивой кроватке на тихой площади перед собором; перед моим окном пара пальм. Здесь я и проведу лето, я должен, после плохих опытов последних лет, попробовать жить у моря и летом. Теневые условия определили мой выбор. Адрес: Мессина (на Сицилии) (до востребования)
С любовью
Ваш Ф.
220. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Дорогой друг, чтобы вы не беспокоились обо мне, сегодня отправляю вам открытку — с просьбой и условием, чтобы вы мне в хорошие времена не писали писем, а лишь, возможно, тоже отправляли открытку. Итак, я достиг своего «края земли», где, по Гомеру, должно обитать счастье. На самом деле, я ещё никогда не чувствовал себя так хорошо, как на прошлой неделе, и мои новые сограждане балуют и портят меня самым милым образом. Может быть, кто-то следует за мной, кто подкупает людей в мою пользу? —
Адрес: Мессина, Сицилия, до востребования.
Моё летнее пребывание.
221. An Franz Overbeck in Basel (Postkarte)
Итак, дорогой друг! Разум победил: — после того, как последние лета в горах так плохо на меня повлияли, и приближение к облакам всегда было связано с ухудшением моего состояния, остаётся только попробовать, что делает лето на море. Город было трудно найти; в конце концов, я смелым прыжком, напрямую, как единственный пассажир, приехал сюда в Мессину, и начинаю верить, что мне больше повезло, чем ума — ибо эта Мессина словно создана для меня; даже мессинцы проявляют ко мне такую любезность и внимание, что я уже начал задумываться о самых странных побочных мыслях (например, не едет ли кто-то за мной, кто подкупает людей ради меня?) Адрес: Messina, Sicilia, poste restante. Твоё доброе письмо заставило меня задуматься и посмеяться. Всегда твой и ваш
Ф. Н.
222. An Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Сердечный привет и поздравления! — С февраля Генуя мне больше не нужна: болезненная тоска, так что день проходит с трудом. Усиление приступов. В Рекоаро стало ещё хуже. Кажется, я сделал превосходный ход! Очень хорошее настроение! Только балуют меня! Ты можешь догадаться, что я не для того поехал в Сицилию, чтобы тратить деньги, но низкие цены, которые мне делают, всё же удивляют меня. У вас холодно? Калабрийские горы, мои визави, покрыты снегом! — Бельё в последнем состоянии! Мне плевать на два оставшихся рубашки! Моя одежда так же проста, как и плоха. Но моя комната 24 фута в длину и 20 футов в ширину. За 4 пфеннига 3 апельсина.
Твой брат.
223. An Paul Rée in Locarno
Мой друг, как мне найти этот многократно упоминаемый золотой самородок, после того как я нашёл „философский камень“ (к тому же это ещё и сердце)? — — Сирокко всегда вокруг меня, мой великий враг, даже в метафорическом смысле. В конце концов, я всё же думаю: „без Сирокко я был бы в Мессине“ — и прощаю своего врага. — В сущности: высшее смирение перед судьбой. — Путешествие смехотворное от начала до конца, я хочу рассказать. Сегодня прямо в Базель, где я буду инкогнито у Овербека, пока ваша телеграмма не позовёт меня в Люцерн. Адрес: Ницше через адрес профессора Овербека, Базель, Эйлергассе. Будущее для меня совершенно закрыто, но всё же не „тёмное“. Я непременно должен ещё раз поговорить с фрейлен Лу, например, в Львином саду? — С безграничной благодарностью ваш друг Н.
224. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz (Postkarte)
Мой дорогой господин издатель, у меня есть несколько вещей, о которых я хотел бы вам рассказать, но из-за проблем с глазами и постоянных головных болей я вынужден ограничиться просьбой. Пожалуйста, отправьте экземпляр моей «Утренней зари» по моему адресу в Цюрих, до востребования, и как можно скорее! — Первый выпуск вашего журнала был достаточно интересным; и особенно введение вызвало у меня некоторое удивление из-за неожиданной гармонии мыслей со мной. Если бы я только мог читать, я бы продолжил чтение! Но остаток моего зрения полностью принадлежит моей цели. Осенью вы можете получить от меня рукопись: название «Весёлая наука» (со многими эпиграммами в стихах!!!)
Лучшие пожелания вам и господину Видеманну!
Преданный вам
Др. Ф. Н.
225. An Franziska und Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Это, возможно, звучит невероятно — но, вероятно, я приеду к вам в Наумбург через Франкфурт в среду днём.
С любовью
Ваш Ф.
Отъезд во вторник вечером из Базеля
226. An Franz Overbeck in Basel (Postkarte)
В Люцерне меня встретили Лу и Ре на вокзале. — Вероятно, я поеду во вторник через Базель в Наумбург, вместе с Ре — престиссимо! - - - Во вторник или среду через 2 недели Лу приедет на день в Базель (вечером путешествие продолжится). Днем она хотела бы прийти к тебе и твоей дорогой жене. Разрешишь? —
Искренне благодарен.
Адр.: Наумбург.
227. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz
Уважаемый господин издатель!
Даже самому серьёзному журналу время от времени нужно что-то весёлое. Вот 8 песен для вашего журнала. Мои условия:
-
чтобы все 8 были напечатаны сразу
-
и открывали номер, следующего по возможности —
-
чтобы они были напечатаны изящными и элегантными буквами, не теми, что для прозаических статей.
На мой «вкус» вы должны положиться безоговорочно. — Согласны? Быстрый ответ в Наумбург-на-Заале, где я немного отдыхаю.
Благодарю за письмо и посылку в Цюрих!
Сердечный привет другу Видеманну!
Др. Ф. Ницше
228. An Franz Overbeck in Basel (Postkarte)
Слово, мой дорогой друг! Пока что у меня всё хорошо. Прекрасная погода. Относительно Лу — глубокое молчание. Так и нужно. — Визит к госпоже Рее теперь точно запланирован, судя по последней открытке Рее. — Мы едим хороший мёд и много говорим о тебе и твоей достойной уважения супруге. Преданный тебе благодарный
Ф. Н.
229. An Paul Widemann in Dresden (Visitenkarte)
ПРОФ. Д-Р НИЦШЕ
Господину Паулю Видеману с сердечным приветом и пожеланием
230. An Paul Rée in Stibbe
Дорогой друг, мне в последнее время было довольно хорошо; наконец я сбежал от сирокко. —
Посмотрите майский номер журнала Шмейцнера: там есть «Идиллии из Мессины». —
Я нанял старого купца, который обанкротился: он пишет по 2 часа в день, пока моя сестра диктует рукопись, а я слушаю и исправляю: единственная роль, которую я могу играть сейчас. — Я был молчаливым и останусь таковым и впредь — вы знаете, по отношению к чему. Это необходимо. —
Нельзя быть друзьями более удивительным образом, чем мы сейчас, не так ли? Мой старый дорогой Рее!
Ваш Ф. Н.
231. An Lou von Salomé in Zürich-Riesbach
Дорогая подруга Лу,
навестите же профессора Овербека — его квартира находится на Эйлергассе 53. —
Здесь в Наумбурге я пока что молчал о вас и нас. Так я остаюсь более независимым и лучше служу вам. —
Соловьи поют всю ночь напролет под моим окном. —
Ре — во всех отношениях лучший друг, чем я есть и могу быть; обратите внимание на эту разницу! —
Когда я совсем один, я часто, очень часто произношу ваше имя — к моему величайшему удовольствию!
Ваш Ф. Н.
232. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz (Postkarte)
Корректурный лист пришёл на день позже, чем открытка, которая его анонсировала. Я немедленно отправил его господину Видеману. Для себя я желаю 4 оттиска (пожалуйста, пришлите их неразрезанными под переплёт!) Также я хотел бы подписаться на этот год вашего журнала для моей сестры. Я остаюсь в Наумбурге ещё 3 недели: встреча с вами, уважаемый господин издатель, в Лейпциге — была бы мне очень желательна. На этот раз, правда, нет рукописи Кёселица для типографии Тойбнера. Я нанял старого купца, который обанкротился — моя сестра и я диктуем по очереди, это для меня пытка.
Ваш Ф. Н.
233. An Ida Overbeck in Basel
Уважаемая госпожа профессор,
при нашей последней встрече я был слишком подавлен: так что оставил Вам и моему другу заботу и тревогу, для которых на самом деле нет оснований; скорее, есть достаточно поводов для противоположного! В сущности, судьба всегда благоволит мне и, по крайней мере, благоволит мудрости — как же мне бояться судьбы, особенно если она является мне в совершенно неожиданном облике Лу?
Обратите внимание, что Ре и я с одинаковыми чувствами преданы нашей смелой и великодушной подруге — и что он и я имеем большое доверие друг к другу и в этом вопросе. К тому же мы не из глупейших и не из самых молодых.
— До сих пор я полностью молчал об этих новых вещах. Тем не менее, это не может продолжаться вечно, и уже по той причине, что моя сестра и госпожа Рэ общаются. Мою мать я, напротив, хочу «оставить в стороне» — у неё и так достаточно забот — зачем ещё ненужные? —Фрейлейн Лу придет к вам в этот вторник днём (также вернёт книгу «Шопенгауэр как воспитатель», которая, действительно, по ошибке попала в мой чемодан). Говорите обо мне с полной свободой, уважаемая госпожа профессор; вы знаете и догадываетесь, что мне больше всего нужно, чтобы достичь моей цели — вы также знаете, что я не «человек дела» и, к сожалению, отстаю от своих лучших намерений. Кроме того, я, именно из-за упомянутой цели, ужасный, ужасный эгоист — и друг Рэ во всех отношениях лучший друг , чем я (в чём Лу не хочет верить.)
Друг Овербек не должен присутствовать при этом частном разговоре? Не так ли? —
Тем временем у меня всё хорошо; говорят, я никогда в жизни не был так весел. В чём же причина?
Преданно благодарный и полностью
ваш
Ф. Н.
234. An Lou von Salomé in Zürich-Riesbach
Моя дорогая подруга,
вы написали мне это прямо по сердцу (и по глазам)! Да, я верю в вас: помогите мне всегда верить в себя и оправдывать наш девиз и вас
„отучаться от половинчатости
„и в целом, добром, прекрасном
„жить решительно“ —
Мой последний план поговорить с вами таков:
Я поеду в Берлин в то время, когда вы будете там, и оттуда немдленно удалюсь в один из прекрасных глубоких лесов, что находятся поблизости от Берлина — достаточно близко, чтобы мы могли встретиться, когда захотим, когда вы захотите. Сам Берлин для меня невозможен.
Так: в «Грюневальде» я останусь и буду ждать всё время, которое вы потом проведёте в Штиббе. Затем я буду к вашим услугам для всех дальнейших намерений: возможно, я найду какое-нибудь достойное лесничество или дом священника в самом лесу, где вы сможете прожить ещё пару дней в моей близости. Ибо, честно говоря, я очень хотел бы как можно скорее побыть с вами наедине. Такие одиночки, как я, должны привыкать к людям, которые им дороже всего, медленно: будьте здесь ко мне снисходительны или, скорее, немного встречайте меня навстречу!Если же вам нравится продолжать путешествовать, то недалеко от Наумбурга мы найдем другую лесную отшельническую келью (в окрестностях Альтенбургского замка; туда я мог бы, если хотите, отправить свою сестру. (Пока все летние планы висят в воздухе, я делаю хорошо, сохраняя полное молчание среди своих — не из любви к тайнам, а из „знания людей“) Моя дорогая подруга Лу, о „друзьях“ и в особенности о друге Ре я хочу объясниться устно: я очень хорошо знаю, что говорю, когда считаю его лучшим другом, чем я есть и могу быть. —
О, плохой фотограф! И все же: какой милый силуэт сидит там на тележке! — Осень, я думаю, мы проведем уже в Вене? На какую постановку вы хотите пойти в Байрейте? Ре, насколько я знаю, имеет билет на первую. — По пути в Байрейт мы еще ищем промежуточное место в пользу вашего здоровья? О моем сегодня не стоит говорить.
От всего сердца ваш Ф. Н.
Говорят, что в своей жизни я не был так весел, как сейчас. Я доверяю своей судьбе. —
235. An Paul Rée in Stibbe
Мой дорогой друг, как дела? Куда путь? И есть ли он вообще? — Что с летними планами? Вчера я сообщил Л<у> о своём новейшем плане: а именно, в одну из ближайших недель я перееду в Груневальд под Шарлоттенбург и останусь там до тех пор, пока Л<у> будет у вас в Штиббе: чтобы затем встретить её и, возможно, сопроводить в какой-нибудь тюрингский лесной курорт, куда, возможно, приедет и моя сестра. (например, замок Хуммельшайн) Пока всё ещё висит в воздухе, я счёл необходимым соблюдать молчание.
Вы уже распорядились своим байрейтским местом? Возможно, отдали его Лу? Это было бы на первую постановку? — Моя сестра с 24-го...
Июль там.
Вчера у меня был Ромундт, который действительно принадлежит к счастливым людям.
У меня всё хорошо, и я весел и трудолюбив. — Рукопись странным образом оказывается „нередактируемой“. Это происходит от принципа „mihi ipsi scribo.“ —!
Я чаще смеюсь над нашей пифагоровой дружбой с очень редким „φίλοις πάντα κοινὰ“. Это даёт мне лучшее представление о себе самом, что я действительно способен на такую дружбу. — Но смеяться всё же остаётся?
С сердечной любовью Ваш Ф. Н.
Вашей уважаемой матери и моей сестре — преданнейшие приветы.
236. An Franz Overbeck in Basel
Мой дорогой друг,
уже несколько дней болен, был крайне болезненный приступ. Я медленно поправляюсь. — А теперь твое письмо! — Такое письмо получаешь только один раз, я благодарю тебя от всего сердца и никогда этого не забуду. Я счастлив за свой замысел, который для непосвященных глаз может показаться очень фантастическим, что я заручился всем добрым человеческим и дружеским разумом от тебя и твоей дорогой жены. Правда в том: в том, как я здесь хочу и буду действовать, я полностью человек своих мыслей, да, самого сокровенного мышления: это соответствие делает мне так же хорошо, как и образ моего генуэзского существования, в котором я тоже не отставал от своих мыслей.
В эту новую будущность вложено множество моих жизненных тайн, и здесь у меня остаются задачи, которые можно решить только делом. — Впрочем, я пребываю в фаталистической «покорности судьбе» — я называю это amor fati — так что я бы бросился в пасть льву, не говоря уже о — —Что касается лета, всё ещё неопределённо.
Я здесь продолжаю молчать. Что касается моей сестры, я твёрдо решил оставить её в стороне; она могла бы только запутать (и себя прежде всего)
Ромундт был здесь; добрый и немного больше на путях разума.
Преданный вам и вашей дорогой жене от всего сердца
Ф Н
237. An Lou von Salomé in Hamburg
Моя дорогая подруга,
я тоже был, как и вы, довольно болен и, как я подсчитал, с того же дня; это даёт мне своего рода горькое удовлетворение — мне совершенно невыносимо думать, что вы страдаете одна.
От Овербека пришло письмо на восемь страниц; в нём было много любви и восхищения к вам и много заботы и беспокойства за нас обоих. Это не мало, что здравый смысл таких трезвых и добрых друзей благоприятствует нашему замыслу. — В остальном я считаю необходимым теперь молчать об этом замысле даже перед ближайшими и лучшими: ни госпоже Рée в Вармбрунне, ни фрейлейн фон
Мейзенбуг в Байройте, и даже мои родственники не должны ломать себе головы и сердца над вещами, которым мы, мы, мы соответствуем и будем соответствовать; в то время как для других они могут быть опасными фантазиями. —
Для Берлина и Груневальда я был так готов, что мог уехать в любой момент. Значит, мы увидимся только в Байройте? И даже тогда только «возможно»? Вармбрунн — не место для меня; кроме того, мне кажется разумнее не выставлять нашу троицу так открыто этим летом, как это произошло бы при пребывании в Вармбрунне: — ради наших осенних и зимних планов. Я слишком известен в этой Германии.
И у меня теперь утренние зори вокруг, и не напечатанные! То, во что я больше не верил — найти друга моего последнего счастья и страдания, — теперь представляется мне возможным — как золотая возможность на горизонте всей моей будущей жизни. Я взволнован, когда думаю о смелой и проницательной душе моей дорогой Лу.
Пишите мне всегда так, как в этот раз! Ничего не читаю с большим удовольствием и легкостью, чем ваш почерк.
От всего сердца
Ваш
Ф. Н.
238. An Paul Rée in Stibbe
Тем временем, мой дорогой дорогой друг, я был болен — да, я всё ещё болен. Поэтому сегодня только несколько слов!
Я считаю теперь установленным, что фрейлейн Лу до байрейтского времени находится в Штиббе — во всяком случае, что она остаётся вместе с вами и вашей матушкой до указанного срока? Это правильное понимание ситуации?
Каким образом её тогда можно будет доставить в Байрейт? Или вы сами, возможно, планируете поездку на юг (Энгадин?)?
Я сам думаю о том, чтобы в начале июля отправиться в путь, так сказать, в Вену: то есть, попробовать провести лето в Берхтесгадене — при условии, что мне не придётся выполнять никаких обязанностей заранее.
В целом я настоятельно прошу Вас молчать о нашем зимнем предприятии против всех: о всём становящемся следует молчать. Как только что-то становится известно слишком рано, появляются и противники, и контрпланы: опасность не мала. —
В Германии, к сожалению, мне трудно жить инкогнито. Тюрингию я полностью оставил.
Я хотел бы как можно скорее узнать, что мне делать и чего не делать, чтобы я мог распорядиться своим летом. Наумбург — ужасное место для моего здоровья.
Адресуйте, дорогой друг, свои следующие строки в Лейпциг, до востребования.
Простите за это письмо, навеянное духом болезни!
В итоге у нас обоих всё очень хорошо; у кого есть такой прекрасный проект перед собой, как у нас?
Рукопись почти готова: но всё ещё неотредактированная. Mihi ipsi scripsi.
Прощайте!
От всего сердца
Ваш Ф. Н.
239. An Lou von Salomé in Hamburg
Да, моя дорогая подруга, я из моего далека совсем не вижу, какие лица необходимо посвятить в наши намерения; но я думаю, мы хотим придерживаться того, чтобы посвящать только необходимых лиц. Я люблю скрытность жизни и от всего сердца желал бы, чтобы вам и мне удалось избежать европейской болтовни. В остальном я связываю с нашим совместным существованием такие высокие надежды, что все необходимые или случайные побочные эффекты сейчас мало впечатляют меня: и что бы ни произошло, мы будем нести это вместе и весь этот маленький сверток каждый вечер вместе бросать в воду — не так ли?
Ваши слова о фрейлен фон
M<eysenbug> побуждают меня вскоре написать ей письмо.
Дайте мне понять, как вы планируете организовать время после Байройта и на какую помощь с моей стороны вы при этом рассчитываете. Мне сейчас очень нужны горы и высокий лес: не только здоровье, но и «весёлая наука» гонят меня в уединение. Я хочу закончить.
Подойдёт ли, если я уже сейчас отправлюсь в Зальцбург (или Берхтесгаден), то есть на путь к Вене?
Когда мы будем вместе, я напишу вам что-нибудь в присланную книгу. —
Наконец: я неопытен и неискушён во всех практических делах; и уже годы я никогда не должен был объяснять или оправдывать перед людьми какие-либо свои поступки. Мои планы я охотно оставляю в тайне; пусть весь мир говорит о моих делах! — Однако природа дала каждому существу разные средства защиты — а вам она даровала вашу великолепную открытость в желаниях. Пиндар однажды сказал: «стань тем, кто ты есть!»
Преданный и верный
Ф. Н.
240. An Lou von Salomé in Hamburg
Ну, дорогая подруга, у вас всегда есть доброе слово для меня, и это доставляет мне большую радость — нравиться вам. Ужасное существование отречения, которое я должен вести и которое так сурово, как любое аскетическое самоограничение, имеет некоторые утешения, делающие жизнь для меня всё ещё более ценной, чем небытие. Некоторые великие перспективы духовно-нравственного горизонта — мои самые могучие источники жизни, и я так рад, что именно на этой почве наша дружба пускает корни и взращивает надежды. Никто не может так от всего сердца радоваться всему, что вами сделано и запланировано!
Преданный вам друг Ф.Н.
241. An Lou von Salomé in Berlin
Моя дорогая подруга
уже полчаса я в меланхолии и уже полчаса спрашиваю себя, почему? — и не нахожу другой причины, кроме только что полученного от Вас драгоценного письма, из которого следует, что мы не увидимся в Берлине.
Вот какой я человек! Итак: завтра утром в 11:40 я хочу быть в Берлине, на вокзале Анхальтер. Мой адрес: Шарлоттенбург под Берлином, до востребования. Мой скрытый замысел: 1) - - - и 2) что через несколько недель я смогу сопровождать Вас до Байрейта, если, конечно, Вы не найдёте лучшего спутника. — Вот что значит внезапно решиться!
С самыми сердечными приветами
Ваш друг Н.
Берхтесгаден для меня «опровергнут». Пока остаюсь в Груневальде. — М<ану>с<крипт> готов. Благодаря самому большому ослу из всех писцов!
Я привезу в Берлин Введение, которое имеет заголовок «Шутка, хитрость и месть» — пролог в немецких рифмах.
242. An Paul Rée in Stibbe
Мой дорогой старый друг, эта немецкая облачная погода приговорила меня к некоей болезни, так что и мой разум порой переставал быть разумным — свидетельство моего последнего письма, за быстрое ответ на которое я вам от всего сердца благодарен.
Свидетельство второе — моя поездка в Берлин, чтобы увидеть Лу и Грюневальд; однако я достиг только второго — навеки! На следующий день я вернулся в Наумбург — полуживой. — Точно так же ничего не вышло из запланированного пребывания в Лейпциге; я выдержал там только один день.
Несмотря на всё это, я полон доверия к этому году и его таинственной игре в кости над моей судьбой.
Я не еду в Берхтесгаден и вообще больше не в состоянии в одиночку что-либо предпринимать. В Берлине я был как потерянная копейка, которую я сам потерял и, благодаря своим глазам, не мог увидеть, лежит ли она у меня под ногами, так что все прохожие смеялись.
Пример! —
Что будет после Байройта? Я сейчас обдумываю, что и моя мать могла бы пригласить фрейлейн Лу, чтобы она провела август в Наумбурге, и чтобы в сентябре мы отправились в путь в Вену.
Выскажите, пожалуйста, своё мнение.Я оставляю билетик нашей очень странной и слишком любезной подруге; я не знаю, где она. —
Вашей уважаемой матери — мой привет и благодарность — Вы же знаете, за что я ей обязан такой благодарностью именно сейчас.
От всего сердца Ваш
Друг Н.
243. An Lou von Salomé in Stibbe
Дорогая подруга
Итак: я совершил небольшое, на первый взгляд очень глупое путешествие в Берлин, где всё пошло не так; на следующий день я вернулся обратно, через Грюневальд и себя самого, немного более просветлённым, чем обычно — с лёгкой усмешкой и очень измотанным. —
Но сегодня я уже снова погрузился в свою фаталистическую «преданность Богу» и снова верю, что всё должно обернуться ко благу, даже это берлинское путешествие и его квинтэссенция (я имею в виду тот факт, что я не увидел Вас)
Я очень хотел бы вскоре поработать и поучиться с Вами и подготовил прекрасные вещи — области, в которых можно открыть источники, при условии, что Ваши глаза хотят открывать источники именно там (— мои уже не достаточно свежи для этого!) Вы же знаете, что я хочу быть Вашим учителем, Вашим проводником на пути к научному творчеству? —
Что Вы думаете о времени после Байройта? Что было бы для Вас самым желанным, полезным и достойным стремления именно для этого периода?
— И стоит ли рассматривать сентябрь как начало нашего венского существования?Моё путешествие снова научило меня моей невыразимой неловкости, как только я чувствую вокруг себя новые места и людей —: я думаю, слепые увереннее полуслепых. Моё желание относительно Вены сейчас — быть доставленным, как посылка, в маленькую комнату того дома, в котором вы хотите жить. Или в соседнем доме, как
Ваш верный друг и
сосед Ф.Н.
244. An Heinrich Köselitz in Venedig
Мой дорогой старый друг, странный год! Уже внешне он выглядит достаточно безумно: представьте, что я путешествовал из Мессины в берлинский Грюневальд, который мне рекомендовал как место для летнего пребывания швейцарский лесничий. Конечно, я не нашел здесь того, что искал — и теперь снова в Наумбурге. Тем временем произошло или было подготовлено многое существенное — и я с изумлением наблюдаю за этой странной игрой в кости и жду и жду. Ибо все должно служить мне во благо: я живу в полной фаталистической «преданности Богу».— Точнее не напишешь.
Сегодня я спрашиваю, можете ли вы помочь мне с корректурой «Весёлой науки» — моей последней книги, как я предполагаю — (о «желании» я не говорю, мой старый верный!) Честность до смерти! Не так ли?
Мучения создания рукописи, с помощью разорившегося старого купца и осла, были необычайными: я поклялся, что больше не допущу ничего подобного.
Я десять раз считал эту книгу неиздаваемой и десять раз снова отрекался от этой веры.
Теперь я думаю так: совсем не важно, что мои нынешние читатели думают об этой книге и обо мне, — но важно, что я так думал о себе, как можно прочитать в этой книге: хотя бы для того, чтобы предостеречь себя самого.С осени начинается для меня новая студенческая пора: я поступаю в Венский университет.
Приедете в Вену? Ах, я не могу вам сказать, как мне не хватает вашего присутствия рядом.
Уединение жизни слишком велико и становится всё больше. —
И ваша музыка! В Базеле я прослушал три раза ваше «Ночь, ты прелесть» — и долго, долго не мог наслушаться. И также те самые радостные 8 тактов
Прощайте, мой дорогой друг!
Ф.Н.
245. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz (Postkarte)
Мой дорогой господин издатель, моё непредсказуемое здоровье и столь же нелогичная летняя погода разрушили все мои добрые намерения. (Например, я хотел провести несколько недель в Лейпциге и думал увидеть Вас там.) — В ближайшие дни Вы получите первую часть М<ану>с<крипт> „весёлой науки“ — я настоятельно прошу, чтобы печать у Тойбнера началась немедленно.
За гонорар и экземпляры — мою лучшую благодарность.
Преданный Вам
Проф. Ницше.
246. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz (Telegramm)
Пожалуйста, завтра в одиннадцать часов, Лейпциг, Нюрнбергерштрассе 6. 1 лестница
Ницше
247. Vermutlich an Paul Rée in Stibbe <Entwurf>
Всё серьёзно, так лучше. В долгосрочной перспективе моё молчание было бы невозможно; оно было необходимо только на ближайшее время, как я и договорился с Овербеком. Мне самому нужно было снова „принадлежать“ своим близким после долгой и глубокой внутренней разлуки. С самого начала они бы не поняли меня с таким начинанием (как наши венские планы); (они бы поверили в сумасшедшую идею или страсть)
248. An Franz Overbeck in Basel (Postkarte)
Дорогой друг, завтра я покидаю Наумбург; мой адрес: деревня Таутенбург возле Дорнбурга (Тюрингия). — Тебе хорошо знакомо! — Тойбнер уже печатает «Весёлую науку»; Кёселиц помогает корректировать. Подготовка м<ану>с<крипта> для типографии была утомительной; надеюсь, в последний раз на долгие годы! — Фрл. Л<у> находится у госпожи Рée в Штиббе, в добром здравии, как и все мы. 24 июля она будет в Байройте. Переезд в Вену, вероятно, состоится уже в сентябре; есть ли у тебя что-то на примете относительно жилья для фрл. Л<у>? — Деньги я не хотел бы иметь сейчас; когда ты будешь в Германии, для этого ещё будет время. — Ромундт я нашёл собранным, смелым и полным планов, к тому же гораздо более разумным и приятным, чем я ожидал. — Сердечный привет твоей дорогой жене!
Ф.Н.
249. An Lou von Salomé in Stibbe
Моя дорогая подруга,
в получасе езды от Дорнбурга, где старый Гёте наслаждался своим уединением, среди прекрасных лесов находится Таутенбург. Там моя добрая сестра устроила для меня идиллическое гнёздышко, которое должно приютить меня этим летом. Вчера я занял его; завтра моя сестра уезжает, и я останусь один. Однако мы договорились о чём-то, что, возможно, снова приведёт её сюда. А именно, если Вы не нашли бы лучшего применения месяцу августу и сочли бы уместным и возможным жить здесь со мной в лесу, то моя сестра провела бы Вас из Байройта сюда и жила бы с Вами в одном доме (например,
у священника, где она сейчас живёт: место предлагает выбор симпатичных скромных комнат) Моя сестра, о которой вы можете спросить у Рее, как раз в это время нуждалась бы в уединении, чтобы высиживать свои маленькие новеллы. Ей чрезвычайно приятно думать о том, чтобы быть рядом с вами и со мной. — Вот так! А теперь откровенность «до смерти»! Моя дорогая подруга! Я ничем не связан и меняю свои планы, если у вас есть планы, с лёгкостью. И если я не должен быть с вами вместе, то скажите мне об этом просто — и даже не нужно приводить причины! Я доверяю вам полностью: но это вы знаете.
—Если мы подходим друг другу, то и наше здоровье будет подходить друг другу, и в чём-то будет скрытая польза. Я никогда не думал о том, что вы должны мне «читать и писать»; но я очень хотел бы быть вашим учителем. Наконец, чтобы сказать всю правду: я ищу теперь людей, которые могли бы стать моими наследниками; я ношу с собой нечто, чего совершенно нет в моих книгах, — и ищу для этого самую прекрасную и плодородную почву.
Видите мою эгоистичность! —
Когда я здесь и там думаю об опасностях вашей жизни, вашего здоровья: моя душа каждый раз наполняется нежностью; я не знаю ничего, что могло бы так быстро сблизить меня с вами. — И затем я всегда счастлив знать, что у вас есть Рée, а не только я в качестве друга. Представлять вас двоих, гуляющих и беседующих вместе, — для меня истинное наслаждение. —
Груневальд был слишком солнечным для моих глаз.
Мой адрес: Таутенбург близ Дорнбурга, Тюрингия.
Преданный вам
Друг Ницше.
Вчера здесь был Лист.
250. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Я благодарю Вас от всего сердца за Ваше письмо; ничего страшного, если иногда "дикое животное" просунет голову сквозь клетку — в конце концов, у нас с Вами, у Вас и у меня, есть наши божественно-весёлые и совсем не звериные часы, ради которых всё же стоит жить — не так ли, старый друг?
Мой адрес: деревня Таутенбург близ Дорнбурга (Тюрингия).
Таутенбург скрыт в лесах. — Приезжайте в Байройт!
Преданный Вам Ваш Ф.Н.
251. An Lou von Salomé in Stibbe
Дорогая подруга
как я рад слышать, что добрый корабль вошёл в добрый порт! Мгновенно мы все трое станем самыми довольными людьми на свете. Этот Таутенбург очаровывает меня и подходит мне во всём; и ещё раз я чувствую, что в этом чудесном году судьба удивляет меня неожиданным подарком. Для моих глаз и моих уединённых склонностей это рай; я понимаю намёк, что время моей южной жизни прошло; путешествие от Мессины до Груневальда стало жирной чертой под этим прошлым.
Тем временем я сообщил всё, что касается вас, моей сестре.
Я нашел её, за долгое время разлуки, настолько продвинувшейся и более зрелой, чем раньше, достойной всяческого доверия и очень любящей ко мне. Её собственные планы на зиму уже определены (она едет в Геную, в мою тамошнюю квартиру, позже в Рим); мои опасения, что они могут пересечься с моими венскими планами, таким образом, рассеялись. Впрочем, у неё теперь есть свои склонности к уединению и «независимости» — и поэтому я считаю, что Вы можете попробовать с ней и с нами. — Но разве моё молчание было необходимо, как вы теперь думаете? Я проанализировал его сегодня и нашёл последнюю причину: недоверие к самому себе.
Я, собственно, был буквально сбит с ног событием — обретением «нового человека» — вследствие слишком строгого одиночества и отказа от всякой любви и дружбы. Я должен был молчать, потому что каждый раз, когда я заговорил бы о вас, это сбивало меня с ног (так было с добрыми Овербеками). Ну, я рассказываю вам это, чтобы посмеяться. У меня всегда всё очень по-человечески, слишком по-человечески, и моя глупость растёт вместе с моей мудростью.
Это напоминает мне о моей «весёлой науке». В четверг придёт первый корректурный лист, а в субботу последняя часть М<ану>с<крипта> должна уйти в типографию. Сейчас я постоянно занят очень тонкими языковыми вещами; окончательное решение о тексте заставляет «слушать» слово и предложение с самой скрупулёзной точностью. Скульпторы называют эту последнюю работу «ad unguem». — С этой книгой завершается ряд сочинений, начавшийся с «Человеческого, слишком человеческого»: во всех вместе должно быть воздвигнуто «новое изображение и идеал свободного духа».
Что это, конечно, не «свободный человек действия», вы, вероятно, давно уже догадались. Скорее — но здесь я хочу закончить и смеяться. От всего сердца вам
и другу Рée преданный Ф.Н.
252. An Heinrich Köselitz in Venedig
К боли.
Кто может убежать от тебя, если ты схватила его,
Когда ты направляешь на него свои серьёзные взгляды?
Я не хочу бежать, если ты меня схватишь,
Я больше не верю, что ты только уничтожаешь!
Я знаю, ты должна пройти через каждое земное существование,
И ничто на земле не остаётся нетронутым тобой:
Жизнь без тебя — она была бы прекрасна,
И всё же — и ты достойна быть прожитой!
Конечно, ты не призрак ночи,
Ты приходишь, чтобы напомнить духу о его силе:
Борьба — это то, что сделало величайших великими,
Борьба за цель на непроходимых путях.
И потому, если ты можешь дать мне только счастье и наслаждение,
Одно, боль, истинное величие,
Тогда приди и давай бороться, грудь к груди,
Тогда приди, и пусть это будет даже на жизнь и смерть —
Тогда проникни в глубину сердца,
Проникни в самую глубину жизни,
Забери мечту обманчивости и счастья,
Забери то, что не было достойно безграничного стремления.
Ты не останешься победителем истинного человека,
Даже если он обнажит грудь перед твоим ударом,
Даже если он сломается в смерти: —
— Ты — основание для величия духа!
253. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Простите, друг! Теубнер (или Шмейтцнер?) всё делает неправильно. Рукопись должна быть у Вас! Стихи ужасно искажены типографами и наборщиками: мне стыдно, что Вы получаете этот непонятный бред.
Адрес по-прежнему: деревня Таутенбург близ Дорнбурга (Тюрингия) —
В дружбе Ф. Н.
Ради бога, Ваша орфография и пунктуация и никаких "stäts"! Или?
254. An Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
До сих пор болен, тяжёлый приступ. — В постели. Гроза за грозой. Нашёл утренний башмак. Не хватает сахара и соли. Также был бы полезен немного мясного экстракта, особенно после приступов. Священник был здесь 2 раза. Да не вкладывать в голову мысли о «внушении недоверия!» Нет никаких оснований для этого! В остальном всё вполне так! — Сельтерская вода очень полезна. Парикмахер не совсем безопасен.
Нашей матери сердечные приветы.
Твой верный брат ФН
Парсифаль: страница 56—93 (слишком длинно!), с предпоследнего такта 231 до середины 238 клавирный выписки
255. An Elisabeth Nietzsche in Naumburg
Здесь, моя дорогая сестра, письмо Лу. —
Что касается твоих зимних планов и их полной независимости, я сам отвечу письменно. — Похоже, что всё идет очень хорошо. Напиши священнику.
Эти перья ужасны, одно хуже другого. Окажи мне услугу, попроси доктора Ромунда прислать мне гросс перьев Humboldt Roeder’s B. Это единственное перо, которым я еще могу писать.
Рукопись полностью готова. Большое и триумфальное чувство, учитывая 6 лет!
Три листа корректуры у меня в руках.
Огромное спасибо за вишню! С тех пор я не ел клубники. Каждый вечер в 6 я в трактире, с тех пор как приступ прошел.
Сделай, пожалуйста, заметку для меня и разных посылок. —
Но теперь ты все же напишешь Лу?
От всего сердца
благодарный
Твой брат
Ф. Н.
(очень в хорошем настроении!)
256. An Lou von Salomé in Stibbe
Моя дорогая подруга,
Теперь небо надо мной светло! Вчера в полдень у меня было как будто день рождения: Вы прислали своё согласие, самый прекрасный подарок, который кто-либо мог бы сделать мне сейчас — моя сестра прислала вишню, Тойбнер прислал первые три оттиска «Весёлой науки»; и ко всему этому как раз была закончена самая последняя часть рукописи, и с этим закончено произведение 6 лет (1876—1882), вся моя «вольнодумность»! О, какие годы! Какие муки всех видов, какое одиночество и пресыщение жизнью!
И против всего этого, как бы против смерти и жизни, я приготовил себе это лекарство, эти свои мысли с их маленькой-маленькой полоской безоблачного неба над собой: — о дорогая подруга, как часто я думаю обо всем этом, я потрясен и тронут и не знаю, как это все же удалось: само-сострадание и чувство победы наполняют меня целиком. Ибо это есть победа, и полная — ибо даже мое телесное здоровье снова, я не знаю откуда, появилось, и все говорят мне, что я выгляжу моложе, чем когда-либо. Небо убережет меня от глупостей! — Но отныне, когда Вы будете советовать мне, я буду хорошо советован и не должен бояться. —
Что касается зимы, то я серьезно и исключительно думал о Вене: зимние планы моей сестры совершенно независимы от моих, здесь нет никаких побочных мыслей. Юг Европы теперь ушел у меня из головы. Я не хочу больше быть одиноким и снова учиться быть человеком. Ах, на этом уроке мне почти все еще предстоит учиться! —
Примите мою благодарность, дорогая подруга! Все будет хорошо, как Вы сказали.
Нашему Рее сердечнейшее!
Целиком Ваш
Ф.Н.
257. An Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Комнаты на первом этаже у пастора, возможно, всё же удобнее?
5 дам из Мерзебурга, которых он охотно принял бы здесь, если я правильно понял, это госпожа фон Хэслер с двумя дочерьми и гувернанткой и госпожа фон Бергсдорф. Или? —
Сердечнейшие приветы
Ф.Н.
258. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz (Postkarte)
Дорогой господин, сегодня остаток M<ану>с<крипта> должен быть отправлен по почте, а именно прямо в типографию, чтобы не было потери времени. На данный момент у меня 3 корректурных листа.
От нашей встречи в Лейпциге у меня осталось приятное послевкусие; она была лишь слишком короткой! —
Мой адрес на лето: Таутенбург близ Дорнбурга, Тюрингия.
Мои наилучшие пожелания всем вашим начинаниям!
Ваш Ницше.
259. An Franziska Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Моя дорогая мама, сегодня в полдень у меня был такой аппетит к вишне — и вот, когда я пришёл домой, она стояла там! Я был в Дорнбурге, как и вчера: чтобы разобраться с теубнеровскими путаницами через телеграммы. Дождливая погода, болотистая местность, терпение! Тем не менее, Таутенбург в долгосрочной перспективе — это правильное место, и важно, что мы нашли его так близко к Наумбургу — с учётом будущих времён. Я хочу остаться здесь на лето. Вот меня как раз укусила блоха. В Дорнбурге, кстати, я могу получить всё, что ещё пожелаю (например, Либиха, кофе и соль), так что оставим Наумбург. Всегда с благодарностью вспоминая о твоей прекрасной заботе
Твой Ф.
260. An Elisabeth Nietzsche in Naumburg
Моя дорогая сестра, теперь я только не хочу выходить из себя из-за почты.
Итак: я написал тебе сразу после прибытия пакета из Наумбурга; также отправил открытку нашей матери, я был так благодарен вам! В понедельник утром мое письмо должно было быть в ваших руках.
Главное: я вложил в письмо к тебе любящее согласие-письмо Лу; в нем так много говорилось и о тебе, в таком ключе, что должно было доставить тебе большое удовольствие. Она полностью согласна и хочет остаться в Таутенбурге на 4 недели. Мне досадно по 100 причинам, что ты не можешь прочитать это письмо. Но напиши ей сейчас и не упоминай о несчастье с письмом и о самом письме.
Тем временем я сделаю всё, чтобы его найти. Почтовая служба здесь для меня невыносима. У меня ежедневно возникают проблемы с ней, и в итоге мне всегда приходится самому ехать в Дорнбург для переговоров. Теубнер напечатал 6 листов; но как я смогу согласовать корректуры с Кёселицем через Таутенбург, я ещё не понимаю. И при этом всё ещё может потеряться! —
В остальном я в очень хорошем настроении (хотя не в очень хорошем здоровье — слишком много гроз в воздухе, день за днём!)
Этой почтовой неудачей я крайне недоволен, моё намерение было как можно скорее избавить тебя от напряжения — и получилось наоборот! — —
Пожалуйста, ради всего святого: стальные перья! Значит, наумбургские: B. John Mitchells classical 689! Позже доктор Ромундт может достать мне единственное полезное для меня перо Humbold B (Roeders).
Все остальные нужды, например, кофе, соль, я могу легко достать сам, также и экстракт Либиха.
С сердечной любовью твой и ваш
Ф. Н.
261. An Franziska Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Моя дорогая мать, только что получил твою посылку; тем временем ты, вероятно, слышала, что моя последняя открытка с благодарностью к тебе затерялась. Постоянно дождливая погода, а между тем внезапная жара и надвигающиеся грозы: очень плохая погода для моей головы! Несколько дней я не мог избавиться от головной боли, и сегодня тоже. В остальном мне здесь всё нравится, особенно дом и хозяева, а также еда в гостинице (вечером в 6). Также кислое молоко мне очень идет. Сделай, пожалуйста, заметку для меня! С самыми сердечными пожеланиями и приветом, твой сын.
262. An Franziska Nietzsche in Naumburg
Моя дорогая мама,
В воскресенье я болел. — Много дел. Большая задержка с печатью. —
Недавно, когда я уходил от тебя, я встретил на вокзале старшего священника с Сушен; большой смех.
Сегодня у меня просьба и немного срочная!
Общество по благоустройству установило здесь две новые скамейки в тех частях леса, где я люблю гулять в одиночестве. Я обещал прикрепить к ним две таблички. Не могла бы ты позаботиться об этом? И сразу же? Поговори с экспертом, какие таблички и надписи лучше всего держатся.
На одной должно быть написано:
Мёртвый человек.
Ф.Н.
На другой:
Весёлая наука.
Ф.Н.
Это должно быть что-то изящное и красивое, что принесёт мне честь. С сердечным приветом
Твой сын Фриц.
263. An Heinrich Köselitz in Venedig
Мой дорогой друг,
нет слов, которые я бы предпочёл услышать из ваших уст, чем «надежда» и «восстановление» — и вот я навязываю вам эту огромную необходимость в правках именно в этом состоянии, когда вокруг вас должно быть райски!
Знаете ли вы мои безобидности из Мессины? Или вы молчали об этом из вежливости к их автору? — Нет, несмотря на то, что дятел говорит в последнем стихотворении — моя поэзия не в лучшем состоянии.
Но что в этом такого! Не стоит стыдиться своих глупостей, иначе наша мудрость мало чего стоит.
То стихотворение «к боли» было не моим.
Это относится к тем вещам, которые имеют надо мной полную власть; я никогда не мог читать это без слёз; это звучит как голос, которого я ждал и ждал с детства. Это стихотворение моей подруги Лу, о которой вы, возможно, ещё не слышали. Лу — дочь русского генерала, ей двадцать лет; она проницательна, как орёл, и смела, как лев, и в то же время очень девичье дитя, которое, возможно, не проживёт долго. Я обязан ей фрейлейн фон Мейзенбуг и Ре. Сейчас она в гостях у Ре, после Байрейта она приедет ко мне в Таутенбург, а осенью мы вместе переедем в Вену.
Мы будем жить в одном доме и работать вместе; она удивительным образом подготовлена именно для моего образа мышления и мыслей.
Дорогой друг, вы, безусловно, оказываете нам обоим честь, удерживая понятие любовной связи от наших отношений. Мы — друзья, и я буду свято хранить эту девушку и это доверие ко мне. — Кстати, у неё невероятно надёжный и честный характер, и она сама очень хорошо знает, чего она хочет — не спрашивая мира и не заботясь о нём.
Это для вас и ни для кого другого. Но если бы вы приехали в Вену, это было бы замечательно!
Наконец: кто же до сих пор мои самые ценные человеческие находки? Вы — затем Рее — затем Лу.
С верными чувствами
Ваш друг Ф. Н.
264. An Malwida von Meysenbug in Mezzaratte bei Bologna (Entwurf)
Пусть теперь рядом с Ольгой и её детьми у вас будет спокойное и утешительное солнечное время; пусть особенно общение с этой любимой душой рассеет или смягчит все те опасения, которые вы выразили мне в Риме; это и ничего другого я мог бы вам пожелать — всё остальное у вас уже есть!
Я сижу здесь посреди глубоких лесов и только что должен заниматься корректурой своей последней книги; она носит название „весёлая наука“ и завершает ту цепь мыслей, которую я начал плести тогда в Сорренто. Ах, я всегда был таким презрителем книг, а теперь сам „виновен в грехе“ или как говорит Грехен? — с 10 книгами!
Следующие годы не принесут книг — но я снова хочу, как студент, учиться. (Сначала в Вене.)
Моя жизнь теперь принадлежит более высокой цели, и я не делаю ничего, что ей не служит. Угадать это никто не может, а выдавать себя я пока не смею! Но что она требует героического образа мышления (и совсем не религиозно-смиренного), я хочу признаться вам, и вам особенно охотно. Если вы встретите людей с таким образом мышления, дайте мне знать: как вы сделали это с молодой русской. Эта девушка теперь связана со мной крепкой дружбой (насколько это возможно в таких случаях).
просто устроиться на земле); я давно не делал лучшего приобретения. Я действительно чрезвычайно благодарен вам и Рée за помощь в этом. Этот год, который в нескольких главных частях моей жизни означает новый кризис (эпоха — правильное слово, промежуточное состояние между двумя кризисами, один позади, один впереди), был для меня очень украшен блеском и очарованием этой молодой, поистине героической души. Я хочу получить в ней ученицу, и если с моей жизнью на долгое время не сложится, то наследницу и продолжательницу.
Между прочим: Рée должен был на ней жениться (чтобы устранить многие трудности её положения); и я, со своей стороны, действительно не жалел поощрений. Но, похоже, это теперь напрасное усилие. Он в одном последнем пункте — непоколебимый пессимист, и как он остался верен себе в этом, вопреки всем возражениям своего сердца и моего разума, в конце концов вселило в меня большое уважение. Мысль о продолжении человечества для него невыносима: он не может переступить через своё чувство, увеличивая число несчастных. На мой вкус, в этом пункте у него слишком много сострадания и слишком мало надежд.
Все строго конфиденциально!
В Байройте некоторые из моих друзей явятся к вам и, возможно, выдадут свои скрытые мысли обо мне; скажите этим друзьям, что со мной нужно подождать и что нет причин для отчаяния.
Подумайте, что я очень доволен, что не должен слушать музыку "Парсифаля". За исключением двух частей (тех же, которые вы мне выделяете), мне не нравится этот "стиль" (это утомительное и перегруженное произведение): это гегелевщина в музыке; и, кроме того, это столь же яркое доказательство большой бедности изобретательности, как и доказательство огромной претенциозности и кальострости её автора. Простите! В этом пункте я строг. — В морали я неумолим.
265. An Elisabeth Nietzsche in Schulpforte (Postkarte)
Моя дорогая сестра, мерзебургские дамы не приедут, и пасторы теперь настаивают на том, чтобы остаться при первом соглашении. Я ещё раз обдумал и нахожу это так и самым приятным (кроме тебя, с той спальной комнаткой наверху!) Значит: если ты уже написала, то напиши немедленно ещё одну открытку пасторам и скажи, что остаётся при первом соглашении. — Ко мне очень любезны: в итоге в моей местности появляется 5 новых скамеек, и самая красивая вокруг бука, совсем для моих нужд в большом уединении, должна называться „Весёлая наука“.
От всего сердца твой брат.
266. An Elisabeth Nietzsche in Schulpforte (Postkarte)
Только что здесь был пастор. Всё обстоит так, как я тебе писал: очень хотят, чтобы осталось по первому соглашению (то есть 12 марок за три комнаты). В случае, если ты хочешь в одиночку взять обе верхние комнаты, просят 8 марок. Остаёмся только при первом плане; чердачная комната должна быть очень улучшена, и дама, которая сейчас там живёт, полностью довольна и выражает это. Сегодня вечером будет построена красивая скамейка. — (У него уже был твой письмо.) У меня нет новостей от Ре. Может быть, снова почта — ?
Я написал фрейлен фон Мейзенбуг в Париж.
Большая задержка в Лейпциге у Тойбнера.
Ужасно!
Сердечные приветы.
267. An Erwin Rohde in Tübingen
Мой дорогой старый друг, ничего не поделаешь, я должен сегодня подготовить тебя к моей новой книге; максимум еще 4 недели у тебя будет покой! Смягчающее обстоятельство в том, что это должно быть последней на долгие годы: — ведь осенью я поступаю в Венский университет и начинаю новые студенческие годы, после того как старые, из-за слишком одностороннего увлечения филологией, немного не удались. Теперь есть собственный учебный план и за ним собственная тайная цель, которой посвящена моя дальнейшая жизнь — мне слишком тяжело жить, если я не делаю этого в самом большом стиле, по секрету скажу, мой старый товарищ!
Без цели, которую я не считал бы невыразимо важной, я не удержался бы наверху, в свете и над чёрными волнами! Это, собственно, моё единственное оправдание для такого рода литературы, какой я занимаюсь с 1876 года: это мой рецепт и моё самодельное лекарство против жизненной пресыщенности. Какие годы! Какие долгие муки! Какие внутренние потрясения, перевороты, одиночество! Кто вынес столько, сколько я? Леопарди, конечно, нет! И если я сегодня стою над всем этим, с радостью победителя и обременённый тяжёлыми новыми планами — и, как я знаю себя, с перспективой новых, более тяжёлых и ещё более внутренних страданий и трагедий и с мужеством для этого!
так пусть никто не смеет сердиться на меня за то, что я хорошо думаю о своём лекарстве. Mihi ipsi scripsi — так и останется; и пусть каждый по-своему делает для себя своё лучшее — это моя мораль: — единственная, что у меня ещё осталась. Если даже моё телесное здоровье проявляется, кому я обязан этим? Я был во всём своим собственным врачом; и как тот, у кого нет ничего раздельного, я должен был лечить душу, дух и тело сразу и одними и теми же средствами. Допустим, что другие могли бы погибнуть от моих средств: зато я также ничего не делаю усерднее, чем предупреждать о себе. Особенно эта последняя книга, которая носит название „Весёлая наука“, заставит многих отшатнуться от меня, возможно, и тебя, дорогой старый друг Роде! В ней есть мой образ; и я точно знаю, что это не тот образ, который ты носишь в сердце.
Итак: будь терпелив, хотя бы потому, что ты должен понять, что у меня звучит: „aut mori aut ita vivere“.
От всего сердца
Твой
Ницше.
268. An Elisabeth Nietzsche in Naumburg
Моя дорогая сестра,
Сегодня я болен.—
Рее думает, что первая байрейтская постановка состоится 24-го; и я вижу, что план поездки Лу составлен соответственно. Пожалуйста, напиши немедленно Л<у> как обстоят дела. Ей нужно прибыть туда только вечером 25-го, значит, она может выехать из Штиббе позже. —
Моё последнее письмо к ней, несомненно, затерялось! (я писал ей ровно 14 дней назад). — крайне неприятно!
Три скамейки готовы. — Возможно, с тобой и Л<у> произойдёт то же, что со мной с Таутенбургом. — Что я до сих пор скрывал от тебя, так это то, что я больше беспокоюсь о её здоровье, чем о своём. — —
Что касается денег и той половины доли, которую ты мне предназначила, то я с удовольствием прошу тебя позволить мне подарить тебе эту самую половину (так что теперь у тебя есть 100 марок на таутенбургские нужды).
Прощай, моё дорогое лама, всё ещё должно наладиться.
Ф. Н.
269. An Lou von Salomé in Stibbe
Ну, моя дорогая подруга, пока что всё хорошо, и в субботу через 8 дней мы снова увидимся.
Возможно, моё последнее письмо к вам не попало в ваши руки? Я написал его в воскресенье две недели назад. Мне было бы жаль; я описал вам в нём очень счастливый момент: несколько хороших вещей пришли ко мне сразу, и лучшей из этих вещей было ваше письмо с согласием! —
Тем не менее: если у нас есть взаимное доверие, то даже письма могут потеряться.
Я много думал о вас и в мыслях разделил с вами столько возвышенного, трогательного и весёлого, что жил, как будто связанный с моей уважаемой подругой. Если бы вы знали, как это ново и необычно для меня, старого отшельника!
— Как часто мне приходилось смеяться над собой!Что касается Байройта, то я доволен тем, что не должен там быть; и все же, если бы я мог совершенно призрачно находиться рядом с вами, шепча что-то вам на ухо, то даже музыка к "Парсифалю" стала бы для меня терпимой (в противном случае она мне невыносима.)
Я хотел бы, чтобы вы предварительно прочитали мою небольшую работу "Рихард Вагнер в Байройте"; друг Рее, вероятно, имеет ее. Я столько пережил в отношении этого человека и его искусства — это была целая долгая страсть: я не нахожу другого слова для этого. Требуемое здесь отречение, необходимое здесь, наконец, обретение самого себя относится к самому суровому и меланхоличному в моей судьбе.Последние написанные слова В<агнера> ко мне находятся в прекрасном экземпляре "Парсифаля" с дарственной надписью: "Моему дорогому другу Фридриху Ницше. Ричард Вагнер, обер-кирхенрат." В то же самое время, отправленная мной, к нему пришла моя книга "Человеческое, слишком человеческое" — и всё стало ясно, но и всё закончилось.
Как часто я, во всех возможных вещах, переживал именно это: "Всё ясно, но и всё закончилось"!
И как я счастлив, моя любимая подруга Лу, что теперь, в отношении нас обоих, могу думать: "Всё в начале и всё же всё ясно!" Доверьтесь мне! Доверяемся друг другу!
С самыми сердечными пожеланиями для вашего путешествия
Ваш друг
Ницше.
270. An Franz Overbeck in Basel (Postkarte)
Мой дорогой друг, сердечная благодарность за твои и ваши усилия. Пока я не получил ответа от Л
Ф.Н.
271. An Franziska Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Прекраснейшую благодарность, моя дорогая мама! Итак: в воскресенье я приеду, а вечером вернусь обратно!
Вчера снова была головная боль. —
Я хотел бы взять с собой обе дощечки в воскресенье с собой! Остаётся с именами. — Ничего, что ржавеет! —
С сердечной любовью Ваш и Ваш
Ф.
(Всегда „Тюрингия“ на каждый адрес мне!)
272. An Heinrich Köselitz in Venedig
Мой дорогой друг,
так пусть же и у меня будет моя летняя музыка! — на это лето ниспадают добрые вещи, как будто мне предстоит отмечать победу. И действительно: подумайте, как с 1876 года во многих отношениях, телесных и душевных, я был скорее полем битвы, чем человеком! —
Лу не справится с партией для фортепиано: но тут, как посланный небесами, в нужный момент появляется г-н Эгиди, серьёзный и надёжный человек и музыкант, который как раз находится здесь, в Таутенбурге (ученик Киля) — по случайности я провожу с ним полчаса, и снова случайностью было то, что, возвращаясь домой после этой встречи, он находит письмо от друга, которое начинается так: «Я только что открыл для себя замечательного философа, Ницше». —
Вы, конечно, остаётесь предметом крайней дискреции; представлены как итальянский друг, чьё имя — тайна. —
Ваши меланхоличные слова «всегда мимо этого» очень глубоко запали мне в сердце!
Были времена, когда я думал о себе точно так же; но между вами и мной, помимо прочих различий, есть и то, что я больше склонен к тому, чтобы меня „подталкивали“ (как говорят в Тюрингии.) —
В воскресенье я был в Наумбурге, чтобы немного подготовить свою сестру к „Парсифалю“. Там со мной произошло нечто странное! В конце концов, я сказал: „дорогая сестра, все это вид музыки я создавал в детстве, когда писал своё ораторию“ — и теперь я достал старые ноты и, спустя долгие годы, снова сыграл их: тождество настроения и выражения было сказочным! Да, некоторые места, например,„Смерть королей“ показалась нам обоим более трогательной, чем всё, что мы видели в «Парсифале», но всё же совершенно в духе Парсифаля! Признаюсь: с настоящим ужасом я снова осознал, как близок я на самом деле с Вагнером. — Позже я не хочу скрывать от вас этот любопытный факт, и вы должны быть последней инстанцией в этом — дело настолько странное, что я не совсем доверяю себе. —
— Вы, конечно, понимаете меня, дорогой друг, что я этим не хотел хвалить Парсифаля!! — Какое внезапное декаданс! И какой кальостризм!—
Одно замечание в вашем письме даёт мне повод отметить, что всё, что вы теперь знаете из моих стихотворений, возникло до моего знакомства с Лу (как и «весёлая» наука). Но, возможно, у вас есть чувство, что я, как «мыслитель», так и как «поэт», должен был иметь некоторое предчувствие Лу? Или это «случай»? Да! Милый случай!
Комедию мы должны прочитать вместе; мои глаза сейчас слишком заняты. Лу приезжает в субботу. Пришлите ваше произведение как можно скорее — я завидую сам себе из-за этой чести, которую вы мне оказываете!
Искренне ваш благодарный друг Ницше.
273. An Elisabeth Nietzsche in Bayreuth (Postkarte)
Моя дорогая сестра, у меня нет твоего адреса! — В остальном всё дошло, машина (великолепная!) и твоя открытка. Я верю, что вам вместе хорошо на душе! — Навестите Овербеков 30-го, Эрлангерштрассе 511 у вдовы Кёлер. — Через пять часов после вашей встречи в Лейпциге я уже получил письмо от Лу. — Напиши точно о времени прибытия.
Подумай, что если не увезти с собой из Байройта пару высоких моментов и переживаний, то не было смысла ехать в Байройт. —
Сердечнейшее тебе и фрейлен Лу! И через вас — всем, кто меня любит!
Ф. Н.
274. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz (Postkarte)
Придумайте же цвет для обложки, дорогой господин Шмейтцнер, который не был бы таким обыденным и повседневным и имел бы какой-то смысл в отношении этой книги. Например, красивый серо-розовый. —
Тойбнер вчера прислал 13-й лист. Всего будет 15—16. Текст для обсужденного между нами замечания на обратной стороне обложки я уже определил. Первые три готовых экземпляра прошу немедленно прислать сюда! —
С самыми сердечными пожеланиями, также и к Байройтским праздникам
Ваш
Ф.Н.
275. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Септуагинта — это греческий перевод Ветхого Завета. Там, конечно, бесчисленное количество раз упоминаются «язычники» («почему бушуют язычники и т. д.»); там всегда стоит по-гречески ἔθνη («народы») — и Ульфила переводит это «народы» буквально как thiut[e] (я не помню правильного окончания). А именно, «thiuta» означало тогда «народ» (вопрос об этимологии слова совершенно независим от этого!) Я утверждаю: готы привыкли, что при их слове для народов они ощущают смысл «язычники», как и грекоязычные христиане при их ἔθνη. — Пришло ли моё письмо о matrim<onio> segr<eto>? Последнее очень ожидается!
От всего сердца
Ф. Н.
Да здравствует Кальостро!
276. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Друг! Поскольку г-н Эгиди уже уезжает 7-го, мне, вероятно, придётся отказаться от Вашего произведения на этот раз!! Но пожалуйста, пожалуйста, порекомендуйте меня этой венской даме, чтобы я мог услышать Вас в Вене: я в крайнем нетерпении по поводу нашей музыки — простите за эту наглость! Но я думал о Байрейте! Старый чародей снова добился огромного успеха, со всхлипываниями старых мужчин и т.д. — Козима, которая всё ещё «испытывает ко мне верную привязанность», пригласила Лу и мою сестру к себе наедине — больше я ничего не знаю.
Моя сестра написала: «боюсь, глухой был бы в восторге от представления».
Обе дамы приезжают сегодня вечером, погода там и здесь ужасно мерзкая.
Ваш старый друг
Ф.Н.
В<агнер> недавно говорил ужасно грустно: «его лучшие друзья Ницше, Роде покинули его; он одинок»
277. An Jacob Burckhardt in Basel
Ну что ж, мой глубокоуважаемый друг — или как мне вас называть? — примите с благоволением то, что я вам сегодня посылаю, с предвзятым благоволением: ибо, если вы этого не сделаете, то у этой книги «Весёлая наука» вам останется лишь насмехаться (она слишком личная, а всё личное по сути комично).
В остальном я достиг точки, где я живу так, как я думаю, и, возможно, я научился за это время действительно выражать то, что думаю. В этом отношении я воспринимаю ваше несчастье как приговор: я хотел бы, в частности, чтобы вы прочитали Sanctus Januarius (Книга IV) в целом, чтобы понять, передаётся ли он как целое. — А мои стихи? - - -
С сердечным доверием
Ваш
Фридрих Ницше.
NB. И какой же адрес того господина Курти, о котором вы мне говорили во время нашей последней, очень приятной встречи?
278. An Heinrich Köselitz in Venedig
Дорогой друг.
Однажды мимо меня пролетела птица; и я, суеверный, как все одинокие люди, стоящие на перепутье, подумал, что увидел орла. Теперь весь мир старается доказать мне, что я ошибаюсь, — и по этому поводу ходит милый европейский сплетни. Кто же теперь счастливее — я, «обманутый», как говорят, который целым летом жил в высшем мире надежды благодаря этому птичьему знаку, — или те, кого «нельзя обмануть»? — И так далее. Аминь.
Вчера, старый друг, на меня напал демон музыки — «представьте себе мой ужас!» — как сказал бы Лессинг.
Моё нынешнее состояние „in media vita“ хочет выразиться и в звуках: я не могу от этого избавиться.
И это правильно: прежде чем я вступлю на новый путь, мне нужно ещё немного поиграть и поскрипать.
Вена почти исчезла с горизонта. Возможно, Мюнхен — при этом я обдумываю и свои отношения с Леви.
Я хотел бы, чтобы вы были в Байрейте: хвалят инструментовку Вагнера в „Парсифале“ как самое удивительное в этом искусстве.
Когда же я услышу вашу музыку! — Сейчас я „немного в „пустыне“ и не сплю некоторые ночи. Но никакого уныния! И тот упомянутый демон был, как всё, что мне теперь попадается на пути (или кажется, что попадается), героически-идиллическим.
Прощайте, дорогой друг!
От всего сердца
Ф. Н.
279. An Lou von Salomé in Bayreuth (Fragment)
[+ + +] и как тяжела даже обязанность друга, который сейчас ещё подходит ко мне. —
Я хотел жить один. —
Но тут милая птица Лу пролетела через дорогу, и я подумал, что это орёл. И теперь я хотел, чтобы орёл был рядом со мной.
Приходите же, я слишком страдаю, чтобы причинять страдания вам. Вместе мы это перенесём лучше.
Ф.Н.
280. An Franziska Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Наша последняя встреча, моя дорогая мать, прошла несколько меланхолично; хотя я приехал с противоположным желанием: немного отдохнуть у тебя, так как чувствовал себя очень уставшим. — То, что таблички всё ещё не прибыли, — это досада: в конце концов, они придут, когда все гости уедут и осенние бури будут у двери. По крайней мере, здесь верят в ноябрь: так холодно и мрачно. — У Гелцера в Йене я провёл самый приятный вечер. От всего сердца твой Ф.
281. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Ну, старый дорогой друг, так Вы снова пережили жестокую пытку корректуры и выстояли, поздравляю Вас и себя — надеюсь, Вы на меня не обиделись! Примерно четвертую часть исходного материала я оставил себе (для научного труда).
Тем временем произошло многое: в общем, всё идёт ко мне на пользу, я прошёл через тяжёлое испытание и выдержал его. — Лу останется со мной ещё 14 дней: осенью мы встретимся снова (в Мюнхене?) У меня мой взгляд на людей; то, что я вижу, существует и вправду, даже если другие этого не видят. Лу и я слишком похожи, „родственны по крови“ (так что я даже не могу её больше хвалить перед Вами!)
От всего сердца
282. An Heinrich Köselitz in Venedig
Мой дорогой друг,
«весёлая наука» прибыла; я сразу же отправляю вам первый экземпляр. Многое покажется вам новым: я ещё при последней корректуре кое-что изменил и кое-что, надеюсь, улучшил. Прочитайте, например, заключения второй и третьей книг; также о Шопенгауэре я высказался более отчётливо (к нему и к Вагнеру я, возможно, никогда больше не вернусь, я должен был теперь определить своё отношение, в связи с моими прежними взглядами — ибо в конце концов я учитель и обязан сказать, в чём я остаюсь тем же и в чём стал другим). Сделайте несколько замечаний по поводу того или иного раздела, дорогой друг. И также о целом и о всей настроении: передаётся ли оно действительно? А именно: понятен ли вообще Sanctus Januarius? После всего, что я пережил, с тех пор как снова нахожусь среди людей, мой сомнение в этом огромно! Я не считал возможным такую степень чуждости и равнодушия к тому, что для меня важнее всего, включая меня самого — во всём этом все «друзья» одинаковы. Кто относится ко мне с большей любовью, чем добрая Мейзенбуг?
— но вот она пишет мне, что убеждена: если бы я «достиг своей вершины, то с радостью вернулся бы к Вагнеру и Шопенгауэру». А Шмейтцнер выражается о «Заратустре» так: «Судя по последнему номеру Вашей новой книги, книготорговец теперь может радоваться, что снова получит от Вас книги „для публики“; это также оживит продажи старых».Отвращение и жалость - - -!
Но, как я уже сказал, это не исключения, это правило. Я даже почувствовал этот факт самым жестоким из всех возможных способов — но это не для письма, и даже не для разговора.
В конце концов, дорогой друг, я справился со всем этим, и моя смелость не уменьшилась во время этого пребывания среди призраков. — Странно! Во всём остальном я самый чувствительный человек: но что касается мнения о мне, то теперь я чувствую себя таким ослино-терпеливым! Как это возможно? —
Живите хорошо! Давайте не будем злиться на жизнь, а станем всё больше теми, кто мы есть — «радостно-знающими».
L<ou> остаётся со мной ещё на неделю. Она — самая умная из всех женщин. Каждые пять дней у нас маленькая трагическая сцена.
— Всё, что я написал вам о ней, — чепуха, вероятно, и то, что я только что написал.От всего сердца
преданный вам и
благодарный
Ф.Н.
283. An Franziska Nietzsche in Naumburg (Postkarte).
Пока что сердечнейшая благодарность, моя дорогая мама. Ренклоды превосходны, возможно, прошли десятилетия с тех пор, как я их не ел.
В следующее воскресенье мы возвращаемся в Наумбург и покидаем Таутенбург.
Подробнее напишем позже.
Твой Ф.
284. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz
Уважаемый господин издатель,
помимо благодарности за Ваше письмо, сегодня я должен выразить свои пожелания относительно бесплатных экземпляров и их отправки. От Тойбнера я получил 4: из них я уже подарил 3. На все экземпляры, которые будут отправлены по Вашей любезности, прошу поставить только эти слова:
Отправитель профессор Ницше
Наумбург на Заале
Барону Герсдорфу в Острихен близ Зайденберга (Силезия)
Университетской библиотеке в Базеле
на имя господина библиотекаря д-ра Зибера.
Профессору д-ру Якобу Буркхардту в Базеле
Профессору д-ру Овербеку, в настоящее время в Дрездене, Сидониенштрассе 7. (2 экземпляра)
Госпоже Марии Баумгартнер в Лёррах (Баден) Тумрингерштрассе.
Д-руPaul Rée, Stibbe bei Tütz Westpreussen.
Проф. Д-р Роде, Университет Тюбингена
Д-р Пауль Фёрстер, Шарлоттенбург, Бимаркштрассе
Мадам М. де Мейзенбуг через адрес Мадам Натали Герцен 2 экземпляра
Париж, rue d’Assas 76.
Гофрат Проф. Д-р Хайнце Лейпциг
Поэту Готфриду Келлеру в Цюрих (достаточно как адрес!)
Д-р Генрих Ромундт, Лейпциг 6 Нюрнбергерштрассе 2-й этаж
Г-ну Кёзелицу я уже отправил, г-н Видеманн уже учтёт или учёл Вашу дружбу. — Адрес отныне: Наумбург на Заале. Преданный Вам
Д-р Ницше
285. An Franz Overbeck in Dresden (Postkarte)
Мой дорогой друг, «весёлая наука» направлена в Дрезден и скоро будет у тебя. Второй экземпляр, который я отправляю, прошу отправить госпоже Ротплец в Мюнхен, адрес которой мне неизвестен. — Эта книга во всех отношениях против немецкого вкуса и современности: и я сам ещё больше. Каждое общение с людьми с тех пор, как я покинул Геную, научило меня этому. — В следующее воскресенье я переезжаю в Наумбург. — Мне было бы интересно узнать, что твоя жена думает о Святом Януарии. Предан вам от всего сердца —
генеуэзец.
Лу и моя сестра передают наилучшие пожелания.
286. An Theodor Curti in Zürich
Уважаемый господин,
мне сказали, что Вы в значительной степени проявили интерес к нескольким моим взглядам; и хотя я принципиально остаюсь в глубоком неведении обо всём, что принято называть «влиянием», я всё же хотел бы сделать в этом случае исключение — во-первых, ввиду того, что я слышал о характере, независимости и духе того, кому я имею честь писать (— это был Якоб Буркхардт, который рассказал мне о Вас), во-вторых, потому что меня совершенно удивляет, что мои политико-социальные майские жуки вызвали серьёзный интерес у политико-социального мыслителя.
Никто не может жить в этих вопросах более «в углу», чем я: я никогда не говорю о подобном, не знаю самых известных событий и даже не читаю газет — да, я сделал из всего этого привилегию! — И поэтому я бы не обиделся, если бы мои взгляды вызвали смех и веселье: но серьёзность? И у вас? Разве я не могу этого прочитать?
Случайно я слышал, что недавно умерший Бруно Бауэр в свои последние годы тоже почерпнул из моих мыслей кое-что по этому вопросу. Кое-какие подобные сообщения добавились: так что я стал любопытен к самому себе.
Простите, уважаемый господин! Теперь вы жертва этого любопытства!
С глубоким почтением
ваш
Проф. Д-р Ф. Ницше
Адрес: «Таутенбург близ Дорнбурга»
(Тюрингия)
287. An Lou von Salomé in Tautenburg
[+ + +]
Люди, стремящиеся к величию, обычно злые люди; это их единственный способ терпеть себя.
Кто не находит великого в Боге, не находит его вообще и должен либо отрицать его, либо — творить (помогать творить).
<3.>
[+ + +]
Огромные ожидания в отношении сексуальной любви портят женщинам взгляд на все дальние перспективы.
Героизм — это настроение человека, который стремится к цели, по сравнению с которой он сам уже не имеет значения.
Героизм — это добрая воля к абсолютному самоуничтожению.Противоположностью героического идеала является идеал гармоничного всестороннего развития — прекрасная противоположность и очень желательная! Но это идеал только для глубоко добрых людей (например, Гёте).
Любовь для мужчин — это нечто совершенно иное, чем для женщин. Для большинства, вероятно, любовь — это своего рода алчность; для остальных мужчин любовь — это поклонение страдающему и сокрытому божеству.
Если друг Рée прочтет это, он сочтет меня сумасшедшим.
Как дела? — В Таутенбурге никогда не было дня прекраснее, чем сегодня. Воздух чистый, мягкий, бодрящий: таким должны быть все мы.
От всего сердца
Ф.Н.
288. An Lou von Salomé in Tautenburg
Об учении о стиле.
Первое, что необходимо, — это жизнь: стиль должен жить.
Стиль должен быть тебе подходящим в отношении к совершенно определённому человеку, которому ты хочешь себя передать. (Закон двойной связи.)
Сначала нужно точно знать: «так и так я бы это сказал и произнёс» — прежде чем можно писать. Письмо должно быть подражанием.
Поскольку у пишущего отсутствуют многие средства говорящего, он должен, как правило, брать за образец очень выразительную манеру выступления: изображение этого, написанное, всё равно неизбежно получится гораздо бледнее.
Богатство жизни выдаёт себя через богатство жестов. Нужно научиться ощущать всё — длину и краткость предложений, знаки препинания, выбор слов, паузы, порядок аргументов — как жесты.
Осторожно с периодом! На период имеют право только те, у кого длинное дыхание и в речи.
У большинства период — это аффектация.Стиль должен доказывать, что человек верит в свои мысли, и не только думает, но и чувствует их.
Чем абстрактнее истина, которую хочешь преподать, тем больше нужно сначала соблазнить чувства.
Такт хорошего прозаика в выборе средств заключается в том, чтобы близко подходить к поэзии, но никогда не переходить в неё.
Невежливо и неумно заранее отнимать у читателя более лёгкие возражения. Очень вежливо и очень умно предоставить читателю самому высказать последнюю квинтэссенцию нашей мудрости.
Ф.Н.
Доброе утро,
моя дорогая Лу!
289. An Lou von Salomé in Tautenburg <Widmung>
Лето 1876
Не назад? И не вперёд?
Даже для серны нет пути?
*
Так жду я здесь и крепко держу,
Что глаз и рука мне удержать дают:
*
Пять футов земли, утренняя заря,
И под мной — мир, человек и смерть.
*
Ф.Н.
Моей дорогой Лу. — Лето 1882
290. An Lou von Salomé in Tautenburg (Zettel)
В постели. Сильнейший приступ. Я презираю жизнь.
ФН.
291. An Lou von Salomé in Tautenburg (Zettel)
Моя дорогая Лу,
Простите за вчерашний день! Сильный приступ моей глупой головной боли — сегодня прошёл.
И сегодня я смотрю на некоторые вещи новыми глазами. —
В 12 часов я отвезу вас в Дорнбург: — но прежде мы должны ещё полчасика поговорить (скоро, я имею в виду, как только вы встанете.) Да? —
Да!
Ф.Н.
292. An Paul Rée in Stibbe
Мой дорогой друг,
я помню, что несколько раз размышлял о том, что вы не написали мне ни одного письма с того момента, как Л<у> была в Штиббе. Теперь я, совершенно без намерения подражать, поступил точно так же — и я уверен, что вы не размышляли об этом. О Л<у> нельзя писать, разве что «о её таланте» (и это тоже было бы лишь формой неписания). Посмотрим, сможем ли мы когда-нибудь заговорить о ней!
—В остальном я вёл себя в этом деле в соответствии с моей личной моралью; и поскольку я не делаю её законом для других, то сегодня у меня нет никакого повода для похвалы или порицания — ещё одна причина не писать писем! —
Я предпринял несколько шагов с целью скорейшего переезда в Париж. —
Находится ли „Весёлая наука“ в ваших руках, самое личное из всех моих книг? Учитывая, что всё очень личное по сути комично, я действительно ожидаю „весёлого“ эффекта. — Прочитайте же Sanctus Januarius в контексте! Там собрана моя личная мораль как сумма моих условий существования, которые предписывают лишь должное, если я хочу себя самого.
Я прилагаю записку для нашей Лу.
Прощайте, дорогой старый друг! И пусть также для вас „все переживания будут полезны, все дни святы и все люди божественны“ — как это есть для меня.
С самыми сердечными пожеланиями
Ваш
Ф. Ницше.
293. An Lou von Salomé in Stibbe
Моя дорогая Лу,
на день позже, чем Вы, я уехал из Таутенбурга, в сердце очень гордый, очень смелый — благодаря чему, собственно?
С моей сестрой я говорил совсем немного, но достаточно, чтобы вернуть новое возникающее привидение в ничто, из которого оно было рождено.
В Наумбурге на меня снова напал демон музыки — я сочинил Вашу молитву жизни; и моя парижская подруга Отт, обладающая чудесным сильным и выразительным голосом, должна однажды спеть её Вам и мне.
Наконец, моя дорогая Лу, старая глубокая сердечная просьба: станьте тем, кто Вы есть! Сначала нужно освободиться от своих цепей, а в итоге — освободиться даже от этого освобождения! Каждый из нас, пусть и по-разному, страдает болезнью цепей, даже после того, как разорвал их.
От всего сердца преданный Вам
благосклонный к судьбе — ибо
я люблю в Вас также
свои надежды.
Ф.Н.
294. An Carl von Gersdorff in Ostrichen
Ну что ж, мой старый друг, наконец и я снова в состоянии послать тебе что-то — и притом настоящее жизненное свидетельство. Теперь, когда я в media vita, у меня есть все основания не быть в претензии к жизни; и я желаю, чтобы ты, мой боевой товарищ по жизни, стал также моим товарищем по победе. —
Впрочем, писать письма для меня бессмысленно, ты это знаешь! Зато мои книги рассказывают обо мне больше, чем сто дружеских писем. Прочти, в частности, Sanctus Januarius в этом смысле. —
Теперь я, старый генуэзец и подражатель Колумба, покинул Геную, самый любимый город на земле. Где ты будешь этой зимой вместе со своей дорогой женой (которой я шлю свои почтительнейшие приветы)
Возможно, в Париже? — Я, во всяком случае, буду там.
Пока что я еще некоторое время останусь в Наумбурге. Несомненно, несколько дней.
От всего сердца твой
Друг Ницше.
295. An Heinrich Köselitz in Venedig
Мой дорогой, дорогой друг, на этот раз к вам приходит «музыка». Я хотел бы, чтобы была создана песня, которую можно было бы исполнять публично, — «чтобы соблазнить людей моей философией». Оцените, подходит ли для этого «Молитва жизни». Великий певец мог бы мне вырвать душу из тела; но, возможно, другие души при этом еще сильнее спрячутся в своем теле! — Можно ли вам придать композиции как таковой что-то, чтобы убрать дилетантский штрих и прием? Что я приложил усилия по своему масштабу, вы, возможно, поверите мне, а именно на слово.
Все названия лекций нуждаются в пересмотре и исправлении.
Ф.Н.
Конечно — так любит друг друга,
как я люблю тебя, загадочная жизнь!
Будь то, что я ликовал или плакал в тебе,
принесла ли ты мне страдание или радость,
я люблю тебя с твоим счастьем и горем,
и если ты должна меня уничтожить,
я болезненно вырываюсь из твоих объятий,
как друг из груди друга.
С всей силой обнимаю тебя,
пусть твое пламя зажжет мой дух
и в жару борьбы
найду разгадку твоей сути!
Тысячелетия думать и жить,
вложи в это все свое содержание, —
если у тебя не осталось счастья, чтобы дать мне,
ну что ж — так дай мне свою боль.
Ваше письмо, свидетельство моего единственного читателя, доставило мне очень, очень много радости. —
Как здоровье „здорового“?
Я останусь еще на несколько дней в Наумбурге на Заале.
296. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz
Уважаемый господин издатель,
учитывая, что я хотел бы уехать из Наумбурга через несколько дней, мне было бы очень желательно, чтобы Вы, согласно заметке в Вашем последнем письме о возвращении Вашего банкира в сентябре, прислали гонорар сюда.
Что касается моей последней книги, то я гарантирую Вам её долговечность среди смены вкусовых течений. Я пишу только то, что было мною пережито, и умею это выразить: такие книги всегда „остаются.“ — —
Моим местом пребывания на ближайшие годы будет Париж. —
У меня нет никаких признаков того, что бесплатные экземпляры находятся в руках заинтересованных лиц. Вероятно, они ещё не в их „головах“. —
С сердечными
пожеланиями Ваш
Др. Ницше.
297. An Otto Eiser in Frankfurt
Дорогой и уважаемый господин доктор,
не правда ли, я не могу проезжать через Франкфурт, не увидев Вас? Да, я бы с удовольствием остался на день, так как речь идет не только о встрече, но и о разговоре. Могу ли я провести этот день у Вас дома — об этом Вы или Ваша уважаемая супруга напишете мне слово на открытке — слово самой безусловной непринужденности, какое уместно не только между больными, но и особенно между друзьями. Да? — Через несколько дней я перееду в Париж и совершу поездку через Франкфурт; куда я прибуду утром около 8 часов.
В основном я могу назвать себя выздоравливающим и по крайней мере выздоравливающим. Странно и невероятно, не правда ли? Остается рассказать Вам кое-что, что, возможно, заинтересует и врача.
От всего сердца Ваш доктор Фридрих Ницше
в настоящее время в Наумбурге на Заале
298. An Lou von Salomé in Stibbe
Моя дорогая Лу,
Всё, что Вы мне сообщаете, очень приятно. Впрочем, мне нужно немного приятного!
Мой венецианский художественный критик написал письмо о моей музыке к Вашему стихотворению; я прилагаю его — у Вас будут свои побочные мысли. Мне всё ещё требуется величайшее решение, чтобы принять жизнь. У меня слишком много впереди, на мне, позади. — Сегодня я переезжаю в Лейпциг, возможно, даже на месяц, если мне что-то удастся. Я хочу воспользоваться библиотекой и работать.
Теперь мне кажется, что моё возвращение «к людям» должно привести к тому, что я потеряю тех немногих, кого ещё имел в каком-то смысле.
Всё — тень и прошлое. Пусть небо сохранит мне мою крупицу человечности! —Из Таутенбурга я забыл рассказать, что пастор был вне себя от удивления, когда на следующий день после вашего отъезда услышал, что в доме была ученица Биддермана. Он считает его самым проницательным философом, а себя — единственным истинным его учеником. 3 марки, которые вы оставили на столе в Дорнбурге, я позволил себе передать от вашего имени в Таутенбургское общество по благоустройству.
Моя сестра не вернулась.
Только что пришло "matrimonio segreto" — после первого просмотра я уже признал его шедевром.Не смейтесь над быстротой моего несчастья — я очень, очень музыкант.
Я рекомендую вам и другу Рée (которому я искренне благодарен за его письмо) подумать о том, как развилось чувство ответственности. Чувство "я" отдельного индивида в стаде, как и его угрызения совести как стадные угрызения совести, необычайно трудно постичь воображением — и вовсе не только вывести логически. Наибольшее подтверждение моей теории стадного инстинкта дало мне недавно размышление о происхождении языка.
Вперёд, моя дорогая Лу, и вверх!
С самыми сердечными пожеланиями Ваш Ф.Н.
Адр: Лейпциг, до востребования.
299. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz (Postkarte)
Уважаемый господин издатель, сегодня я переезжаю в Лейпциг и, вероятно, останусь там до конца месяца. Мой адрес на первое время: до востребования. (Адрес доктора Ромундта: «Нюрнбергская ул., 6, 2-й этаж») С отправкой денег нет никакой спешки: если я только успею в течение месяца. Вы можете указать мне лейпцигский дом, где я смогу получить сумму? — Следуют две превосходные фотографии, лучше этого не сделает и художник.
Др. Ф. Н.
300. An Elisabeth Nietzsche in Tautenburg
Через два-три дня, моя дорогая Лизбет, я уезжаю; я написал Эйзерам, которых хочу навестить во Франкфурте, и как только я узнаю от тебя адрес господина Зульгера, всё будет в порядке. Вчера я получил от тебя две открытки — из Мессины через Рим и Базель — честь почте! —
Я также прекрасно справился с работой, назначенной для Наумбурга (композицией), и при этом достаточно удовлетворил себя. —
Если бы я только мог передать тебе понятие о моей радостной уверенности, которая вдохновляла меня этим летом! Мне всё удалось, и многое вопреки ожиданиям — как раз тогда, когда я думал, что потерпел неудачу.
Лу тоже очень довольна (сейчас она полностью погружена в работу и книги). Для меня это очень важно: она обратила Ре в одну из моих главных идей (как он сам пишет), что полностью изменило основу его книги. Вчера Ре написал: «Лу определенно выросла в Таутенбурге на несколько дюймов».
Мне очень грустно слышать, что ты все еще страдаешь от последствий тех сцен, которых я бы от всего сердца хотел тебе избежать. Но держись только этой точки зрения: благодаря волнению этих сцен вышло на свет то, что иначе, возможно, долго оставалось бы в темноте: что Лу имела меньшее мнение обо мне и некоторое недоверие ко мне; и если я внимательнее обдумаю обстоятельства нашего знакомства, то, возможно, у нее было на это хорошее право (учитывая влияние некоторых неосторожных высказываний друга Ре). Но теперь она, безусловно, думает обо мне лучше — и это ведь главное, не так ли, моя дорогая сестра? В остальном, когда я думаю о будущем, мне было бы тяжело предположить, что ты не разделяешь моих чувств по отношению к Лу.
У нас такое сходство дарований и намерений, что наши имена когда-нибудь должны быть названы вместе; и любое оскорбление, которое их коснётся, ударит по мне в первую очередь.
Но, возможно, это уже слишком много по этому поводу. Ещё раз благодарю тебя от всего сердца за всё доброе, что ты сделал для меня этим летом — и я поистине очень ценю твоё сестринское расположение даже в тех случаях, когда ты не мог разделить мои чувства. Да, кто может без опасности вступать в общение с таким аморальным философом, как я! Моя система мышления безусловно запрещает мне две вещи: 1) раскаяние 2) моральное негодование. —
Будь снова добр, дорогое Лама!
Твой брат.
301. An Franz Overbeck in Basel
Мой дорогой друг, вот я снова сижу в Лейпциге, старом книжном городе, чтобы познакомиться с несколькими книгами, прежде чем снова отправиться в дальние края. С немецкой зимней кампанией, вероятно, ничего не выйдет: мне во всех смыслах нужно ясное погода. Да, характер у него есть, у этого облачного неба Германии, примерно, как мне кажется, как у музыки Парсифаля — но плохой. Передо мной лежит первый акт "Тайного брака" — золотая, сверкающая, хорошая, очень хорошая музыка!
Тойтенбургские недели пошли мне на пользу, особенно последние; и в целом я имею право говорить о выздоровлении, хотя достаточно часто напоминаю себе о неустойчивом равновесии моего здоровья.
Но чистое небо надо мной! Иначе я потеряю слишком много времени и сил!Если ты прочитал Sanctus Januarius, то заметил, что я пересёк поворотный круг. Всё лежит передо мной по-новому, и не пройдёт много времени, прежде чем я увижу ужасное лицо моей дальнейшей жизненной задачи. Это долгое богатое лето было для меня испытательным временем; я прощался с ним крайне смело и гордо, ибо в этот период я хотя бы почувствовал, что обычно столь отвратительная пропасть между желанием и исполнением преодолена. Были жёсткие требования к моей человечности, и я справился с самым трудным.
Это целое промежуточное состояние между "некогда" и "когда-то" я называю "in media vita"; и демон музыки, который после долгих лет снова посетил меня, заставил меня говорить об этом и в звуках.
Самое полезное, что я сделал этим летом, — это мои разговоры с Лу. Наши интеллекты и вкусы в глубине родственны — и, с другой стороны, столько противоречий, что мы друг для друга самые поучительные объекты и субъекты наблюдения. Я еще не встречал никого, кто умел бы извлекать из своих переживаний столько объективных прозрений, никого, кто так много понимал бы из всего изученного.
Вчера Рée написал мне: «Лу, безусловно, выросла на несколько дюймов в Таутенбурге» — ну, возможно, и я тоже. Я хотел бы знать, существовала ли когда-нибудь такая философская открытость, как между нами. L<ou> теперь полностью погружена в книги и работу; её величайшая услуга, которую она оказала мне до сих пор, заключается в том, что она убедила Рée реформировать свою книгу на основе одного из моих главных идей. — Её здоровья хватит только на 6—7 лет, как я боюсь.
Таутенбург дал Лу цель.
— Она оставила мне трогательное стихотворение «Молитва жизни».К сожалению, моя сестра превратилась в смертельного врага Лу. Она была полна морального негодования с начала до конца и теперь утверждает, что знает, что к чему в моей философии. Она написала моей матери, что «видела, как моя философия воплощается в жизнь в Таутенбурге, и была потрясена: я люблю зло, она же любит добро. Если бы она была хорошей католичкой, то ушла бы в монастырь и искупала бы все беды, которые от этого произойдут». Короче, наумбургская «добродетель» против меня, между нами настоящий разрыв — и даже моя мать однажды так забылась, что я велел упаковать чемоданы и утром уехал в Лейпциг. Моя сестра (которая не хотела приезжать в Наумбург, пока я там был, и все еще находится в Таутенбурге) иронично цитирует: «Так начался закат Заратустры». — В самом деле, это начало от начала. — Это письмо для тебя и твоей дорогой жены, не считайте меня человеконенавистником. От всего сердца
Твой Ф.Н.
Сердечный привет госпоже Ротплец и ее близким!
Я еще не поблагодарил тебя за твое сердечное письмо.
302. An Franziska Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Моя дорогая мать, приступ головной боли и 2 бессонные ночи пока что, также проблемы с глазами. Но хотя бы устроился, с большим усилием и поисками! Ромундт в отъезде; я провел одну ночь в его квартире. Адрес, следовательно, для письма от Шмейтцнера:
Лейпциг, Ауэнштрассе, 26, 2-й этаж у
учителя Яникауда.
Недалеко от Розенталя. Внутренний город пока что почти сводит меня с ума.
Твой Ф.
Иначе — до востребования.
Совсем по-студенчески, 15 марок в месяц. Спокойно.
303. An Paul Rée in Stibbe
Мой дорогой друг,
я считаю, что мы оба и мы трое достаточно умны, чтобы быть и оставаться добрыми друг к другу. В этой жизни, где люди, подобные нам, так легко становятся призраками, которых боятся, давайте будем радоваться друг другу и стараться доставить друг другу радость; и будем изобретательны в этом — я, со своей стороны, должен многому научиться, так как был изолированным чудовищем.
Моя сестра тем временем обратила всю враждебность своей натуры, которую обычно вымещает на матери, против меня и формально порвала со мной в письме к моей матери, из отвращения к моей философии, и «потому что я люблю зло, а она — добро» и тому подобный бред. Она осыпала меня насмешками и издевательствами — ну, правда в том, что я был терпелив и мягок с ней всю жизнь, как я должен быть с этим полом: и, возможно, это её избаловало. «Даже добродетели наказываются» — сказал мудрый Санкт Януарий из Генуи.
Завтра я пишу нашей дорогой Лу, моей сестре (потеряв естественную сестру, мне должна быть дарована сверхъестественная сестра). И в начале октября — до встречи в Лейпциге! Ваш
Друг Ф.Н.
Auenstr. 26, 2-й этаж.
304. An Jenny Rée in Stibbe
Глубокоуважаемая госпожа,
посмотрите на это изображение и не пугайтесь: это я. Давно я искал случая дать вам знак, как многое связывает меня с вами и как я благодарен вам — уже много лет и в последнее время всё больше. Сегодня фотограф прислал снимки; и первый должен иметь честь быть отправленным вам, глубокоуважаемая госпожа. Ваш сын Пауль и я остались друг другу верными друзьями на долгий срок, и теперь, когда наша дружба стала своего рода троицей, у нас есть ещё одна причина оставаться хорошими друзьями, чтобы сделать жизнь нашей дорогой третьей в союзе немного более сносной и достойной её натуры. Всё доверие, которое вы нам в этом оказываете, — это нечто, перед чем я испытываю глубокое уважение —: я благодарю вас за это от всего сердца.
Ваш
Др. Ф. Ницше.
305. An Lou von Salomé in Stibbe
Моя дорогая Лу, ваша мысль о редукции философских систем к личным действиям их создателей — поистине мысль из «братьев-сестёр»: я сам в Базеле рассказывал историю древней философии в этом смысле и часто говорил своим слушателям: «эта система опровергнута и мертва — но личность за ней неопровержима, личность невозможно убить» — например, Платон.
Сегодня я прилагаю письмо профессора Якоба Буркхардта, с которым вы, как я помню, хотели познакомиться. У него тоже есть нечто неопровержимое в его личности; но поскольку он настоящий историк (первый среди всех живущих), то он как раз этим, этой навсегда усвоенной манерой и личностью, не удовлетворён — он очень хотел бы хоть раз посмотреть другими глазами, например, как показывает это странное письмо, моими. Впрочем, он верит в скорую и внезапную смерть от удара, по примеру своей семьи; возможно, он хотел бы видеть меня своим преемником на кафедре? — Но моя жизнь уже распланирована. —
Тем временем профессор...
Ридель здесь, президент немецкого музыкального общества, за мою «героическую музыку» (я имею в виду вашу «Молитву жизни»); он загорелся — он непременно хочет её, и не исключено, что он её подготовит для своего великолепного хора (один из первых в Германии, называемый «Общество Риделя»). Это был бы такой маленький путь, по которому мы оба вместе попали бы в потомство — другие пути оставлены. —
Что касается вашей «характеристики меня самого», которая, как вы пишете, истинна: мне вспомнились мои стихи из «Весёлой науки» — стр. 10, с заголовком «Просьба». Угадайте, моя дорогая Лу, о чём я прошу?
—Но Пилат говорит: «что есть истина!» —Вчера днём я был счастлив; небо было голубым, воздух мягким и чистым, я был в Розентале, куда меня привлекла музыка «Кармен». Там я просидел 3 часа, выпил второй в этом году коньяк, в память о первом (ха! как он был противен!) и размышлял во всей своей невинности и злобе, нет ли во мне каких-то задатков безумия. В конце концов я сказал себе нет. Затем начала играть музыка «Кармен», и я на полчаса погрузился в слёзы и биение сердца. — Но когда вы это прочитаете, то в конце концов скажете: да! и сделаете заметку к «характеристике меня самого». —
Приезжайте же, пожалуйста, как можно скорее в Лейпциг! Зачем только 2 октября? Прощайте, моя дорогая Лу!
Ваш Ф.Н.
306. An Gottfried Keller in Zürich
Глубокоуважаемый господин,
я хотел бы, чтобы Вы уже знали откуда-то, что Вы для меня — очень глубокоуважаемый человек, мужчина и поэт. Тогда мне не пришлось бы сегодня извиняться за то, что недавно отправил Вам книгу.
Возможно, эта книга, несмотря на своё весёлое название, причиняет Вам боль? И, поистине, кому бы я меньше хотел причинить боль, чем именно Вам, радующему сердце! Я так благодарен Вам!
Искренне Ваш
Д-р Фридрих Ницше
(бывший профессор университета
Базеля и на три четверти швейцарец)
307. An Heinrich Köselitz in Venedig
Наконец, дорогой друг, я смог услышать что-то из вашей музыки; чтобы это стало возможным, мне пришлось переехать в Лейпциг, и даже здесь не сразу нашёлся посредник. В общем, вчера днём мы, а именно старый Ридель (президент немецкого музыкального общества, который пытался ознакомиться с всей клавирной партитурой в течение пары дней) и я, сидели, склонившись над этой «музыкой для итальянцев», и делали это с сердечным восхищением её создателем. (Что касается вас — имени, личности, прошлого — я, конечно, соблюдал крайнюю осторожность: едва ли Ридель знает, что композитор — немец.) Всё так завершено и мастерски; Ридель всё время говорил «прекрасно», «очень прекрасно», особенно в гармоническом плане. Что касается мелодии, то не всё было по его вкусу (он как раз влюблён в крайне контрапунктическое реквием Дрезеке —)
Я сам, дорогой друг, медлителен в любви, проявите ко мне терпение! Чтобы назвать что-то, что мне очень понравилось: увертюра, вторая половина второй страницы, особенно с легатиссимо.
— Ваш стиль приобрёл симфоническую широту, причём в темпе аллегро и, прежде всего, в самой аллегрии: в чём теперь лучшие не имеют дыхания. — Ваше речитатив полно музыки, и ни сухо, ни пьяно — вообще бросается в глаза некоторое итальянское отвращение к немецкой чувственной пьянке. — В конце концов, я всё же хотел бы поверить, что эта музыка — итальянская музыка для немцев, даже для вагнерианцев. При этом наслаждаешься счастьем второй невинности.Нет ничего проще, чем поставить здесь этой зимой Ваше „Sch<erz>, L<ist> und R<ache>“.
Предприниматель, некогда знаменитый Штегеман, ищет новинку и не находит ничего, капельмейстер г-н Никиш восхваляется со всех сторон как великий дирижёр, как тонкий и жаждущий новшеств музыкант, который с страстью работал бы над вашим произведением. Это момент, когда кухня горяча, нужно только засунуть в неё блюдо. Но я ничего не знаю о судьбе и местонахождении вашего произведения. Кстати, и я, слушая вашу музыку, немного возжелал итальянской «сентиментальности».
В Мессине, где я дышал воздухом Беллини (Катания — его родной город), я понял, что без тех 3, 4 слёз нельзя долго выдерживать веселье (Мои идиллии из Мессины написаны по этому рецепту.)
Также музыкальный издатель Фрич полностью готов посвятить себя лейпцигскому исполнению одного из ваших произведений; Никиш тесно с ним дружит. —
Из ваших двух последних писем я понял, — или учуял? — что между нами существует какое-то огромное различие — ну, ничего личного, старый дорогой друг, а что-то, связанное с целью, смыслом и терпимостью жизни. Предположите, что та молитва жизни (могу я её снова получить?) — это комментарий к «Весёлой науке» (некий бас к ней).
— Сама песня, впрочем, принадлежит Лу, она подарила её мне при прощании в Таутенбурге (где мы провели вместе три недели.)Я остаюсь здесь до конца месяца. Ромундт берёт на себя фабрику по производству красок. Герсдорф писал о вас с любовью, он, похоже, смущён как автор Веймарского плана. О своей жене он восхваляет «красоту, чистоту и разумность, которые вместе составляют очень милое существо». — Якоб Буркхардт хочет, чтобы я стал «профессором всемирной истории»; я прилагаю его письмо.
Ваша музыка, значит, продолжает путь к Овербекам? А пока я ещё хочу посидеть под этим солнцем — ах, друг, если бы я мог сказать вам, какая пятерная тьма хочет меня обволочь, и какое сопротивление я должен оказывать. — Избегайте людей! Наш каждый — это стекло, которое слишком легко даёт трещину — и тогда всё кончено.
От всего сердца
Ваш друг Ф.Н.
Последние новости: 2 октября сюда приезжает Лу; через пару недель мы уезжаем — в Париж, и там, возможно, останемся на годы. — Моё предложение.
308. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz (Postkarte)
Уважаемый господин издатель, не сочтите за труд отправить экземпляр моей последней книги госпоже Ротплец, Мюнхен, Фюрстенштрассе 13. —
Деньги в Наумбурге до сих пор не поступили; я бы хотел получить их сюда: Лейпциг, Ауэнштрассе 26, 2-й этаж — и как можно скорее.
С глубоким уважением. Ваш
Профессор Ницше.
309. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Мой дорогой друг, вы, вероятно, уже получили моё письмо? Оно пришло достаточно поздно — но мне не удалось сделать кое-что, прежде чем я смог насладиться первым звуком вашего великолепно-нежного искусства. И сегодня я всё ещё очень недоволен в этом отношении: с тех пор, как я встретился с Риделем, я ничего не слышал: я так неизвестен в Германии! Сегодня я иду к Фричу (я уже дважды не застал его дома). Я часто напеваю про себя первую вокальную пьесу вашего произведения, которая мне нравится. — Странный год! На прошлой неделе я пережил нечто волосы дыбом, но я переношу всё с лёгкостью и почти сразу снова взмываю в светлую высоту, всё увереннее в своей вере, что всё идёт мне на пользу. Встреча с переживаниями, которые ведут к развитию моего последнего решения в мыслях, часто кажется мне сказочно-странной.
С любовью и благодарностью Ф. Н.
310. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Дорогой друг, я только что вернулся от капельмейстера Н<икиша>. Он проявляет наибольшую готовность в отношении „Ш<утки>, Х<итрости> и М<ести>“ и просит немедленно прислать партитуру. Дайте указание в Веймар, адресовать её мне (чтобы здесь осталось скрытым, что она пришла из Веймара). Я настоял на том, чтобы вы выступали в этом деле только под псевдонимом, даже в деловых отношениях. К Штегеману (адрес просто: г-н Шт. Директор нового театра) не обращайтесь раньше, чем Н<икиш> поговорит с ним. Если всё пойдёт быстро, я сам принесу ему ваше письмо и ваши условия во время визита. — Очень рад, что могу дать вам надежду
Ваш
Ф. Н.
311. An Lou von Salomé in Stibbe
Моя дорогая Лу,
как ваши глаза? — Возможно, вам стоит плавать каждые два дня; у нас здесь два бассейна с приятной температурой (20°), также для дам. —
Тем временем я активно взялся за постановку оперы моего венецианского друга в Лейпцигском театре; пока всё идёт хорошо, и мне идут навстречу самым любящим образом. Предположим, я достигну этой цели, то композитор переедет в Лейпциг на эту зиму. —
В самом деле, общество Риделя поставит „Молитву жизни“*; проф.
Ридель чрезвычайно увлечён этим и сейчас переделывает его для хора на 4 голоса (что мои глаза не выносят). При этом возникла необходимость изменить текст в 2 местах: гласный I непригоден везде, где в музыке должен быть достигнут сильный акцент. — о самой музыке Кёселиц недавно написал: «совсем Манфред, величественная, мощная, но жуткая». (то есть: она ему не нравится.) —
Также Герсдорфы хотят приехать в Лейпциг; «весёлая наука» снова всё наладила между нами, и даже больше того.
Герсдорф писал, что часто думает о Рее, и с ежедневной благодарностью за превосходно приятный табак.
Ромундт, собираясь уезжать, во всяком случае хочет дождаться вашего и Рее прибытия. — Также с доктором Цилем я возобновил знакомство. — Гофратша Хайнце предоставила мне в распоряжение кабинет и библиотеку своего супруга, это моя старая детская подруга (исключительно проницательная маленькая колючка, с которой никто не уживается — за исключением моей скромной персоны)
Я прилагаю вырезку из берлинской газеты, интересной из-за разных толкований Кармен. Наконец в Германии доходят до того, что эта опера (лучшая из существующих) содержит трагедию!
Я лично знаю фрейлейн Лилли Леманн; она однажды приезжала в Байройт, когда я как раз гостил у Вагнера, и мы с ней совершили несколько прогулок. Если я здесь задержусь подольше, то обязательно посмотрю постановку «Кармен»; для этого я снова окажусь «у источника». И Лилли должна будет петь главную партию, она, кажется, делает своё дело чертовски хорошо. (Вырезку верните мне, пожалуйста, в Лейпциге, вместе с двумя письмами)
Но что я так много болтаю, моя дорогая Лу, пером! Продолжение устно. И когда?
Преданный вам от всего сердца
Ф.Н.
(Ауэнштрассе 26, 2 этаж)
312. An Elisabeth Nietzsche in Tautenburg (Entwurf)
Этот тип душ, как у тебя, моя бедная сестра, мне не нравится: и меньше всего они мне нравятся, когда еще и нравственно раздуваются, я знаю вашу мелочность. — Я предпочитаю быть осужденным тобой.
313. An Franziska und Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Zettel)
Мои дорогие,
случайно на ярмарке я нашёл такой изысканный имбирь, что не могу не послать вам фунт его. Вместе с сухарями он даёт превосходное блюдо. Также говорят, что имбирь благотворно влияет на душу.
Ф.
314. An Franziska Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Но, моя дорогая мама, где же мои вещи? Последний срок, который я установил для этого, прошёл; и при этом морозе отсутствие халата было суровым (я, следовательно, простудился). Также мне нужны книги (и фраки!). В Наумбург я приехать не могу. — В остальном у меня всё хорошо, и всё идёт вперёд и удаётся мне (это, в конце концов, праздничный год для меня): только здесь меня балуют, как в Мессине, со всех сторон. С сердечным приветом
Ф.
Фрл. Лу и Рée здесь, ожидается Кёзелиц, также Гёрсдорфы хотят приехать.
315. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Но, дорогой друг, не говорите так со мной! Иначе я почувствую себя невыносимым, и притом для самых дорогих мне людей. Партитура все еще отсутствует. О Лёэн! Если бы я мог ему написать! — Лу и Рее прибыли: приезжайте же, как только мы будем уверены в Никише для „Шутки, хитрости и мести“, немедленно! Вы найдете здесь сплошь мирных и трудолюбивых людей, которые высоко и хорошо о вас думают. — Общество Риделя исполнит мою „Молитву жизни“ (теперь хор). — Сегодня вечером большое главное выступление лейпцигского спиритизма, по приказу духов: которые утверждают, что это заседание будет очень важным для истории спиритизма: будет затронута какая-то личность — Достаточно, я должен быть при этом, и есть 6 человек, которые в волнении ожидают, что я скажу по этому поводу. Лучшее „медиум“, но на позднем сроке беременности. Сегодня духи „появятся“, например, „русская монахиня“ и „ребенок“. — Присутствуют два врача. От всего сердца Ваш
Ф. Н.
316. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Дорогой друг, спиритизм — это жалкое мошенничество, которое через полчаса становится скучным. И этот профессор Цёлльнер позволил себя обмануть этому медиуму! Ни слова больше об этом! Я ожидал чего-то другого и заранее был вооружен тремя прекрасными физиолого-психолого-моральными теориями: но мне совсем не понадобились мои теории! — —
Партитура все еще не пришла!
Ваш друг Ф. Н.
317. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Наконец, дорогой друг, партитура попала в мои руки, и через два часа она должна быть передана капельмейстеру Никишу. —
Погода неприятная.
Искренне Ваш Ф. Н.
Партитура выглядит такой чистой и нетронутой — — — —!
318. An Heinrich Köselitz in Venedig (Postkarte)
Сегодня утром, дорогой друг, я снова был у Никиша, но он ещё не посмотрел партитуру ((завален репетициями «Манфреда» (на следующей неделе), «Нюрнбергских мейстерзингеров» и «Маккавеев» Рубинштейна (начало ноября)) Я сказал ему, что вы хотите приехать как можно скорее, что-то сыграть ему и т.д., что, казалось, его очень обрадовало; он пригласил меня присутствовать при этом — (что я, с вашего любезного разрешения, с удовольствием принял бы!) В самом деле, нужно поторопиться; две недели лени Лёниша были несчастьем. Завтра я пойду к Штегеманну; зимний семестр уже начинается! Напишите мне немедленно, сможете ли вы приехать (я, собственно, не сомневаюсь, что мы здесь справимся, но, возможно, я «фантаст»!)
До свидания, дорогой друг!
Ф.Н.
319. An Franziska und Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Postkarte)
Красивый торт вы не должны были мне посылать: в любом случае я сердечно благодарю за него. — С 15 октября началась зима. — Господин Кёзелиц прибыл и создаёт прекрасную музыку. — Завтра мы вместе посетим большой концерт Р<ихарда>-Вагнера (все билеты проданы), на котором выступят байройтские артисты; среди прочего можно будет услышать отрывок из «Парсифаля».
С наилучшими пожеланиями
Ф. Н.
320. An Heinrich Romundt in Neuenstaden bei Freiburg (Fragment)
Ницше сообщает ... о предстоящем в ту же неделю отъезде фрейлейн Лу Саломе из Лейпцига ... В том же письме Ницше ... уже написал: Лу, полностью погруженная в религиозно-исторические размышления, — это маленький гений, наблюдать за которым и немного помогать — счастье для меня. [+ + +]
321. An Lou von Salomé in Leipzig (Widmung)
Подруга — сказал Колумб — не верь
Больше ни одному генуэзцу!
Он всегда смотрит в синеву,
Дальнее слишком его манит!
***
Кого он любит, того зовет охотно
Далеко в пространство и время — —
над нами звезда сияет рядом со звездой,
Вокруг нас бушует вечность.
***
Моей дорогой Лу.
322. An Heinrich von Stein in Halle
Уважаемый господин доктор,
я лишился вашего визита, это мне жаль — письмо отозвало меня в тот день из Лейпцига прочь. —
Могу ли я позволить себе сегодня отправить вам корректурные листы моей последней книги? Так у вас будет хотя бы возможность пообщаться со мной и в Гале (другая возможность, что я когда-нибудь приеду к вам, остаётся в силе).
Мне рассказывали, что вы, больше, чем кто-либо другой, возможно, обратились к Шопенгауэру и Вагнеру сердцем и умом. Это что-то неоценимое, при условии, что для этого есть время.
Преданный вам от всего сердца
Д-р Ницше.
323. An Louise Ott in Paris
Досточтимая подруга,
Или я не могу больше использовать это слово после шести лет?
Тем временем я жил ближе к смерти, чем к жизни, и, следовательно, стал немного слишком «мудрым» и почти «святым»...
Впрочем: это, возможно, ещё можно исправить! Ведь я снова верю в жизнь, в людей, в Париж, даже в себя самого — и хочу вскоре увидеть Вас снова. Моя последняя книга называется: «Весёлая наука».
Много ли над Парижем ясного неба? Не знаете ли Вы случайно о комнате, которая мне подойдёт? Она должна быть расположена в мёртвой тишине, очень простая. И не слишком далеко от Вас, моя дорогая госпожа Отт.
Или Вы советуете мне не приезжать в Париж? Не место ли это для отшельников, для людей, которые хотят тихо работать над своим жизненным трудом и совсем не интересуются политикой и современностью?
Вы для меня такое милое воспоминание!
Преданный Вам от всего сердца
Профессор доктор Ф. Ницше
324. An August Sulger in Paris
Уважаемый господин доктор,
небо знает, что получится из моего переезда в Париж, если Вы не протянете мне немного руку. К тому же Гёте говорит: «благороден будь человек, полезен и добр» — и базельцы, судя по моему опыту, не так уж редко бывают такими. - - -
Таким образом, примерно через 10 дней я прибуду в Париж, утром около 10 часов (Лейпциг — Франкфурт — Париж) — при условии, что Вы, полуслепого, встретите меня там и «поможете обосноваться»! Комната, очень простая, но в самом тихом окружении, такая мертвая тишина, которая подходит мне, отшельнику и червяку мыслей: возможно, Вам случайно известно что-то подобное. Иначе придется искать.
Напишите мне слово, есть ли у Вас доброе намерение или нет: тогда в нужное время Вы получите окончательное сообщение о дне моего прибытия.
Узнаете ли Вы меня снова? Или нам нужно «договориться о розовой ленточке», мой дорогой господин доктор?
С сердечным приветом
Проф. д-р Ницше
Лейпциг, Ауэнштрассе 26, 2-й этаж.
325. An Lou von Salomé vermutlich in Berlin
Дорогая Лу, пять слов — у меня болят глаза.
Я получил ваше петербургское письмо. Два дня назад я также написал вашей матери (и довольно долго)
Также в Париж я отправил два запроса. —
Какая меланхолия!
Я не знал до этого года, насколько я недоверчив. А именно — к себе. Общение с людьми испортило мне общение с самим собой.
Вы хотели мне ещё что-то сказать?
Ваш голос нравится мне больше всего, когда вы просите. Но этого не слышно достаточно часто.
Я буду усерден — —
Ах, эта меланхолия! Я пишу чепуху. Как мелки мне сегодня люди! Где ещё есть море, в котором можно действительно утонуть! Я имею в виду человека.
Моя дорогая Лу
я ваш —
преданный — —
Ф.Н.
(Рэ и госпоже Рэ — сердечный привет!)
326. An Hermann Levi in München
Уважаемый господин капельмейстер,
я думаю, вы всё же как-то ещё помните меня, пусть даже как тень, которая не может решиться полностью принадлежать подземному миру? Действительно, я жил годами ближе к смерти, чем к жизни, и в этот период позволил себе все привилегии умирающих — в частности, «говорить правду».
Теперь, когда я снова пробудился к жизни, возможно, к долгой жизни, я ещё не могу отказаться от хорошей привычки, о которой только что упомянул: вот вам сразу пример. Итак: я верю, что музыка может быть в сто раз лучше, чем музыка Вагнера.
Простите! — —
Это побуждает меня порекомендовать вам друга, который вскоре едет в Мюнхен, чтобы — наблюдать за вами и слушать, когда вы дирижируете. Он хочет таким образом у вас учиться и просит меня, высокоуважаемый господин капельмейстер, расположить вас к нему. Но как я могу это сделать! Совсем тихо на ухо: этот музыкант, господин Петер Гаст, кажется мне новым Моцартом.
Я более или менее знаю, какого ученика посылаю к какому учителю. (Латинская конструкция — )
От всего сердца ваш
Проф. д-р Фридр. Ницше.
Лейпциг, Ауэнштрассе 26, 2-й этаж.
327. An Franz Overbeck in Basel
Мой дорогой друг, так и есть! Я не писал, чтобы дождаться решения по нескольким вопросам, и сегодня пишу только для того, чтобы сказать тебе это; ибо пока ничего не решено. Даже в отношении моих планов на путешествие и зиму. Париж по-прежнему стоит на первом месте, но нет сомнений, что мое самочувствие под влиянием этого северного неба ухудшилось; и, возможно, я никогда не переживал таких меланхоличных часов, как в этом лейпцигском осеннем сезоне — хотя у меня есть достаточно причин, чтобы быть в хорошем настроении. В общем, было много дней, когда я в душе снова путешествовал через Базель к морю.
Я боюсь шума Парижа и хотел бы знать, достаточно ли там ясного неба. С другой стороны, в новом генуэзском одиночестве таится немало опасностей. — — Признаюсь, я бы очень хотел подробнее рассказать тебе и твоей дорогой жене о переживаниях этого года: есть о чём поговорить, но мало что можно написать.За книгу Янсена я тебе очень благодарен, она превосходно проясняет все различия между его и протестантским взглядом (всё это дело сводится к поражению немецкого протестантизма — во всяком случае, протестантской «историографии»). Мне самому в основном не пришлось многому переучиваться. Ренессанс остаётся для меня вершиной этого тысячелетия; и всё, что произошло с тех пор, — это великая реакция всех видов стадных инстинктов против «индивидуализма» той эпохи.
Лу и Ре в эти дни уехали, сначала чтобы встретиться с матерью Ре в Берлине: оттуда они отправляются в Париж. Со здоровьем Лу дело обстоит плачевно, я даю ей теперь гораздо меньше времени, чем ещё этой весной. У нас хватает забот; Ре как будто создан для своей роли в этом деле.
Для меня лично Лу — настоящая находка, она оправдала все мои ожидания — едва ли возможно, чтобы два человека могли быть роднее, чем мы.
Что касается Кёселица (или, вернее, господина «Петера Гаста»), то здесь моё второе чудо этого года. В то время как Лу подготовлена к ранее почти скрытой части моей философии, как никто другой, Кёселиц — это звучащее оправдание всей моей новой практики и возрождения — чтобы сказать совсем эгоистично. Здесь новый Моцарт — у меня нет других ощущений: красота, сердечность, веселье, полнота, изобилие изобретательности и лёгкость контрапунктической мастерства — всё это никогда не сочеталось так, я уже не хочу слушать другую музыку. Как бедно, искусственно и театрально звучит для меня теперь вся вагнерия! — Будет ли здесь представлено Шутка, Хитрость и Месть? Я верю в это, но ещё не знаю. —
Этот портрет, который я прилагаю, пусть будет найден на твоём праздничном столе (его восхищаются как фотографию.)
Получила ли госпожа Ротплец мою последнюю книгу? Я забыл её точный адрес.
От всего сердца желаю тебе хорошего года, твой друг
Ницше
328. An Louise Ott in Paris
О, моя дорогая подруга, едва я сказал вам, что приеду, как должен сообщить, что еще долго не приеду, — что могут пройти еще несколько месяцев.
Но если я приеду, то надолго! — и если не смогу жить в сердце Парижа, то, возможно, в Сен-Клу или Сен-Жермене, где отшельник и червяк мыслей может лучше вести свою тихую жизнь.
От всего сердца благодарный вам
Фридрих Ницше.
329. An August Sulger in Paris
Дорогой господин доктор,
как мило Вы написали! Но с моим путешествием ещё придётся подождать. Эта глупая зимняя погода так на меня действует, что я теряю желание дольше мириться с севером и его пасмурными небесами. Здоровье говорит: «едь на юг» — Надеюсь, весной оно скажет мне: «едь в Париж».
Тогда я надеюсь, что смогу пожаловать Вам руку в знак благодарности.
С сердечным приветом
Ваш
Проф. Д. Ницше
330. An Ernst Schmeitzner in Chemnitz
Уважаемый господин издатель,
речь идёт о заказе — он хочет от Вас мою фотографию, (ту большую)
Мой адрес: Генуя (Италия) до востребования.
Отъезд сегодня.
Проф. Ницше
330a. An Gustav Dannreuther in Boston
Уважаемый господин,
только по вашему предложению снова появляются мои портреты — и, как говорят, очень похожие. Но самое точное изображение дают мои сочинения, при условии, что они воспринимаются и ощущаются как целое с той любящей страстью, которая звучит в ваших словах ко мне. И что бы ни было опровержимо в моих мыслях: — сама личность есть нечто неопровержимое. Даже ошибки имеют ценность, если они способствуют созданию полного образа моей личности.
Я дал своему издателю поручение проинформировать вас о моих новых работах. Последняя называется «Весёлая наука» — название, которое может показаться вам, как последователю Шопенгауэра, чужим и странным. Но это хорошая вещь — всякая радость.
Преданный вам от всего сердца
Проф. д-р Ф. Ницше
Адрес: Генуя (Италия) до востребования.
331. An Carl von Gersdorff in Ostrichen
Мой старый дорогой друг,
сегодня ночью я снова отправляюсь на юг, в свою резиденцию в Геную. Север и зима мне не подходят — я отложил парижские планы (хотя мадам Отт вчера прислала мне цветы)
Твои последние письма очень мне помогли, я благодарю тебя от всего сердца.
Твой друг Ф.Н.
Адрес: Genova poste restante.
332. An Heinrich Köselitz in Leipzig (Postkarte)
Мой адрес теперь
Санта-Маргерита, Лигурия
ferma in posta.
Мои самые сердечные пожелания с вами, друг! Надеюсь, жизнь удаётся вам немного лучше, чем мне. Я и здесь ещё не преодолел кошмар, который принёс этот год.
Ваш Ф. Н.
Холодно. Болен. Я страдаю.
333. An Franz Overbeck in Basel (Postkarte)
Дорогие друзья, пока что всё шло не очень. Поездка через перевал Готтард была ледяной и холодной, без отопления. Мою квартиру в Генуе я нашёл сданной внаём, сама Генуя была ледяной, холодной и дождливой, всё шло наперекосяк. Наконец я отправился в Портофино и остановился в Санта-Маргерите. На следующий день (до сих пор) сильный приступ головной боли, с рвотой и т.д. Моя комната ледяная и холодная, как и все впечатления от поездки. Тем не менее, я не знаю ничего лучшего, чем остаться. «Горе» всегда со мной — где-то сказано (у Шекспира?) Прошу вас, если ещё что-то придёт, отправляйте по адресу Santa Marguerita Ligure, до востребования.
Сегодня / Я страдаю.
Ваш Ф.Н.
Жизнь с вами была оазисом. — —
334. An Paul Rée, vermutlich in Berlin
Но, дорогой, дорогой друг, я думал, вы почувствуете наоборот и втайне обрадуетесь, что на время избавились от меня! В этом году было сто моментов, начиная с Орты, когда я чувствовал, что дружба со мной обходится вам слишком «дорого». Я уже слишком много получил от вашего римского открытия (я имею в виду Лу) — и мне всегда казалось, особенно в Лейпциге, что у вас есть право стать немного молчаливее со мной.
Думайте обо мне, дорогой друг, как можно лучше, и попросите Лу сделать то же самое для меня.
Я принадлежу вам обоим с самыми сердечными чувствами — я считаю, что моё отсутствие доказало это больше, чем моя близость.Всякая близость делает нас неудовлетворёнными — и в конце концов я вообще неудовлетворённый человек.
Время от времени мы всё же будем встречаться, не так ли? Не забывайте, что с этого года я внезапно стал беден любовью и, следовательно, очень нуждаюсь в ней.
Напишите мне что-нибудь совсем точное о том, что нас сейчас больше всего волнует, — о том, что «стоит между нами», как вы пишете.
С всей любовью
ваш
Ф.Н.
NB. Я так хвалил вас в Базеле, что фрау Овербек сказала: «Но вы же описываете Даниэля де Ронду!» Кто такой Даниэль де Ронда?
Адр.: Санта-Маргерита Лигуре
пост-рестанте.
335. An Lou von Salomé, vermutlich in Berlin
Моя дорогая Лу,
вчера я написал прилагаемое письмо Рее: и вот я уже был в пути, чтобы отнести его на почту — как вдруг мне пришла в голову мысль, и я снова разорвал конверт. Это письмо, которое касается только вас, возможно, доставит Рее больше затруднений, чем вам; короче, прочтите вы его, и пусть будет полностью в вашей власти, должен ли Рее его тоже прочитать. Примите это как знак доверия, моего чистейшего желания доверия между нами!
И теперь, Лу, дорогое сердце, создайте чистое небо! Я больше ничего не хочу, во всех отношениях — только чистое светлое небо: иначе я уже проложу себе путь, как бы тяжело это ни было.
Но одиночка страшно страдает от подозрения в отношении тех немногих людей, которых он любит, — особенно если это подозрение, что они питают подозрение против всей его сущности. Почему до сих пор в нашем общении не было никакой радости? Потому что я должен был прилагать слишком много усилий: облако на нашем горизонте лежало на мне!
Возможно, вы знаете, как невыносимо для меня всё, что стремится пристыдить, всё обвинение и необходимость оправдываться. Человек совершает много несправедливости, неизбежно — но у него есть и великолепная противоположная сила: творить добро, создавать мир и радость.
Я чувствую каждое движение высшей души в вас, я люблю в вас только эти движения.
Я охотно отказываюсь от всякой доверительности и близости, если только могу быть уверен в одном: что мы чувствуем себя едиными там, куда не достигают обычные души.Я говорю темно? Обрету ли я доверие, вы уже увидите, что у меня есть и слова. До сих пор я всегда должен был молчать.
Дух? Что мне дух! Что мне познание! Я не ценю ничего, кроме побуждений — и я готов поклясться, что в этом у нас есть нечто общее. Взгляните сквозь эту фазу, в которой я жил последние годы — взгляните за неё! Не дайте себе обмануться насчёт меня — вы же не думаете, что „свободный дух“ — мой идеал?! Я —
Простите! Дорогая Лу!, будьте тем, кем вы должны быть.
Ф.Н.
336. An Unbekannt: Lou von Salomé? (Disposition)
Фриц
„Так вы не станете
— Овербеков
— Манфред
— Человек в детской шляпе!
— тогда я был ужасно зажат
(казалось, потерян)
— не всегда справлялся со своими сочинениями
— без отца и советчика
— Нильсон
— Рее
— погода, настроение, объекты, например, Лу
— у меня теперь вершина всего морального размышления и труда в Европе
— я был вдруг
филолог, писатель, музыкант, философ
вольнодумец и т.д. (возможно, поэт? и т.д.).
— Скобелев
— лекции в Лейпциге
— с князьями
— добрый, благородный, великий.
— сострадание — моя слабая сторона.
Если вы сказали: я скоро умру и т.д.— Скромность. Я удивляюсь себе.
— „очаровательно, поистине, есть пища
„еще очаровательнее, кто её ел.“
Идиллии из Мессины Психологическая проблема 2 времена. Я боялся и преодолел себя. Я не хочу больше скрываться. Что-то молодое, грациозное, легкомысленное, глубокое, непостоянное — заставляет меня плакать.
Где нужда наибольшая, там Лю ближе всего (в Генуе, размышляя о Байрейте, ни одного нового побуждения)
для меня орёл
слова ласкать и гладить
как разговаривать с моим демонионом
что нужно для величия?
невыносимо для меня причинять боль, например, через это молчание.
— Генуэзская девка
Коровы, кошки и птицы
337. An Lou von Salomé in Berlin (Entwurf)
Что вы делаете, моя дорогая Л
должен ли я сказать: всё кончено
Хотим ли мы вместе разозлиться? у нас есть желание устроить большой шум? Я совсем не хочу, я хотел ясного неба между нами. Но вы же маленький проказник! И когда-то я считал вас воплощением добродетели и честности.
338. An Lou von Salomé in Berlin (Entwurf)
М<оя> д<орогая> Л<у>, я должен написать вам небольшое злобное письмо. Ради бога, что думают эти маленькие девочки 20 лет, у которых приятные любовные чувства и ничего больше не делать, кроме как время от времени болеть и лежать в постели? Следует ли бегать за этими маленькими девочками, чтобы разгонять их скуку и мух? Случайно провести приятную зиму? Очаровательно: но что мне до приятных зим? Должен ли я иметь честь внести свой вклад
339. An Paul Rée in Berlin (Entwurf)
Странно! У меня есть предвзятое мнение о Л<у>: и хотя я должен сказать, что весь мой опыт этого лета противоречит ему, я не могу от него избавиться. Ряд высших чувств, которые среди людей очень редки и очень отличительны, должны быть или были в ней: какое-то главное несчастье
На самом деле никто в моей жизни не вёл себя со мной так отвратительно, как Л<у>. До сих пор она не отозвала то мерзкое клеветническое обвинение всего моего характера и воли, с которым она представилась в Йене и Таутенб<урге>: и это несмотря на то, что она знает, что это нанесло мне значительный вред в его последствиях (а именно в отношении Базеля). Кто не прерывает общение с девушкой, которая говорит такие вещи, тот, должно быть, — я не знаю, что он такое — так заключают.
Что я этого не сделал, было следствием этого предвзятого мнения: впрочем, с моей стороны это было хорошим примером самопреодоления.Роде, который недавно упрекнул меня в том, что весь мой новый образ мышления — это эксцентричное решение, называет меня мастером самопреодоления.
Что мне, впрочем, становится труднее всего, так это то, что я не могу поговорить ни с вами, ни с Лу, ни с кем-либо другим о том, что лежит у меня на сердце.
Как я поступил бы с человеком, который так говорил бы обо мне моей сестре, в этом нет никаких сомнений. В этом я солдат и всегда им буду, я разбираюсь в оружии. Но девушка!И Лу!
она не только оставила меня в Байройте, но и пренебрежительно обошла (моя сестра рассказала 100 историй) — в этом пункте я чувствителен, ибо чтобы мои друзья умели оценить моё поведение против В<агнера> и признать за мной право, это входит в понятие „мой друг“
кто не понимает этих вещей, тот не знает, что значит „приносить жертвы познанию“
Не можете ли вы привести эти вещи в равновесие? Я никогда не хотел говорить с Лу об этом, кроме одного пункта, о котором вы знаете.
В главном, я хотел оставить ей свободу, чтобы она сама исправила случившееся: мне отвратительно всё вынужденное между двумя людьми.
Когда я видел её в последний раз, она сказала, что должна мне ещё что-то сообщить. Я был полон надежды. (Я сказал своей Д<уше> „У неё очень плохое мнение обо мне, но она умна, скоро оно изменится“
я хотел бы, чтобы самое болезненное воспоминание этого года было снято с моей души — болезненное не потому, что она оскорбила меня, а потому, что она оскорбила Лу во мне.
340. An Unbekannt: Paul Rée? (Entwurf)
Невероятный результат этого лета, что Л
К тому же такое совместное проживание противоречит моему вкусу — — —
341. An Unbekannt: Paul Rée? (Entwurf)
У меня есть амбиции светского святого — но вы и все остальные сделали меня в прошлом году очень недоверчивым к самому себе. И от досады на это недоверие я был на грани гибели.
Теперь Лу распространила слухи через фрау Гелцер и мою сестру
именно Лу!
Это жестокость судьбы.
Сострадание — ад.
Терпеть в молчании; — самопреодоление
342. An Heinrich von Stein in Halle
Но, дорогой господин доктор, вы не могли бы ответить мне более прекрасно, чем сделали это — прислав свои листы. Это совпало удачно! И при всех первых встречах должно быть такое хорошее «птичье знамение»!
Да, вы поэт! Я это чувствую: аффекты, их смена, не в последнюю очередь сценический аппарат — это действенно и правдоподобно (на что всё и зависит!)
Что касается «языка», — ну, мы поговорим о языке, когда встретимся: это не для письма. Конечно, дорогой господин доктор, вы читаете ещё слишком много книг, особенно немецких книг! Как можно только читать немецкую книгу!
Ах, простите!
Я сам это сделал и пролил при этом слёзы.Вагнер однажды сказал обо мне, что я пишу по-латыни, а не по-немецки: что, во-первых, верно, а во-вторых — и моему уху приятно. Я просто не могу иметь больше, чем долю участия во всём немецком. Посмотрите на мою фамилию: мои предки были польскими дворянами, даже бабушка моего деда была полькой. Ну, я делаю из своего полунемецкого происхождения добродетель и претендую на то, что понимаю в искусстве языка больше, чем это возможно немцам. —
Так что в этом до свидания!
Что касается «героя»: я не думаю о нём так хорошо, как вы.
В конце концов: это самая приемлемая форма человеческого существования, особенно если нет другого выбора.
Что-то становится дорого: и едва оно становится по-настоящему дорогим, как тиран в нас (которого мы так охотно назвали бы нашим "высшим Я") говорит: "Именно это принеси мне в жертву". И мы приносим — но при этом есть мучение животных и сжигание на медленном огне. Это почти сплошь проблемы жестокости, которые вы рассматриваете: вам это нравится? Я говорю вам откровенно, что и сам имею слишком много этой "трагической" комплекции в теле, чтобы не проклинать её часто; мои переживания, большие и малые, всегда идут по одному и тому же пути.
Тут меня больше всего тянет на высоту, с которой трагическая проблема будет под мной. — Я хотел бы у человеческого существования отнять что-то от его разрывающего сердце и жестокого характера. Но, чтобы продолжить здесь, мне пришлось бы открыть вам то, что я ещё никому не открывал — задачу, которая стоит передо мной, задачу моей жизни. Нет, об этом мы не должны говорить друг с другом. Или, вернее: такие, как мы оба, два очень отдельных существа, мы об этом не должны даже молчать друг с другом.
От всего сердца благодарный вам
и преданный
Ф. Ницше.
Я снова в своей резиденции в Генуе или поблизости, более отшельник, чем когда-либо: Санта-Маргерита Лигуре (Италия) (до востребования).
343. An Heinrich Köselitz in Leipzig
Мой дорогой друг,
несмотря ни на что — я не хочу переживать последние недели во второй раз.
К тому же я замерзал, как никогда в жизни. Наконец, я сбежал в отель, прямо у моря, и в моей комнате есть камин.
Моё королевство теперь простирается от Портофино до Цоальи; я живу в центре, а именно в Рапалло, но мои прогулки ежедневно ведут меня к указанным границам моего королевства. Главная гора в этих местах, поднимающаяся от моего жилища, называется «весёлый горный хребет», Монте аллегро: хорошее предзнаменование — надеюсь.
Приезжайте на этот раз через Геную — в жизни у нас не будет больше такого.
Я покажу вам, как дьявол, все «великолепия мира» и даже не хочу вас «соблазнить»! —Генрих фон Штейн написал мне, очень притихший (не расстроенный, как казалось) и «с почтительным приветом».
Но что вы скажете: у меня новый поклонник — а именно Ганс фон Бюлов («преданное участие» ко мне)
Мир круглый и должен вращаться: давайте сделаем «хорошую музыку» к этому, старый друг! Время от времени, пожалуй, можно и самому немного потанцевать, но никто не хочет танцевать с этими шарманщиками — они для этого не созданы.
Addio, да здравствует бог Италии.
Ваш друг Ф. Н.
Вашему отцу — моё почтение и благодарность — благодарность за то, что господин Петер Гаст есть и что он тот, кто он есть! —
Адрес всё тот же, Санта-Маргерита Лигуре.
344. An Hans von Bülow in Meiningen
Глубокоуважаемый господин,
по какому-то счастливому стечению обстоятельств я узнаю, что Вы — несмотря на моё отчуждающее одиночество, к которому я вынужден с 1876 года — не стали мне чужими: я испытываю при этом радость, которую трудно описать. Это приходит ко мне как подарок и вновь как нечто, чего я ждал, во что верил. Мне всегда казалось, что, как только я вспоминал Ваше имя, мне становилось легче и увереннее на сердце; и если я случайно что-то слышал о Вас, я сразу думал, что должен это понять и одобрить. Я думаю, что в своей жизни я так постоянно хвалил немногих людей, как Вас — простите! Какое у меня право Вас «хвалить»!
— —Тем временем я жил несколько лет слишком близко к смерти и, что хуже, к боли. Моя натура такова, что способна долго мучиться и как бы сжигаться медленным огнём; я даже не умею быть достаточно мудрым, чтобы «потерять рассудок». Я не говорю о опасности моих аффектов, но это я должен сказать: изменившийся способ мышления и чувствования, который я выразил в письменной форме за последние 6 лет, сохранил меня в существовании и почти сделал меня здоровым. Какое мне дело до того, что мои друзья утверждают, будто моё нынешнее «вольнодумство» — это эксцентричное, удерживаемое зубами решение, вырванное и навязанное моей собственной склонности?
Хорошо, это может быть "вторая природа": но я все же хочу доказать, что только с этой второй природой я действительно обрел владение своей первой природой. —Так я думаю о себе: в остальном почти весь мир думает обо мне очень плохо. Моя поездка в Германию этим летом — перерыв в глубокой одиночестве — научила и напугала меня. Я нашел всю милую немецкую скотину, бросающуюся на меня — ведь я для них совсем не "достаточно морален".
Хватит, я снова отшельник и больше, чем когда-либо; и придумываю — следовательно — что-то новое. Мне кажется, что только состояние беременности снова и снова привязывает нас к жизни. —
Итак: я есть тот, кто был, Кто Вас от всего сердца почитает
Ваш преданный
Д-р Фридрих Ницше
(Санта-Маргерита Лигуре |Италия| poste rest.)
345. An Erwin Rohde in Tübingen
Мой дорогой друг,
я снова на „юге“; я всё ещё не могу выносить северное небо, Германию и „людей“. С тех пор было много болезней и меланхолии.
При твоём чрезвычайно желанном письме, которое застало меня в Санта-Маргарите, я испытал особую радость: услышать от тебя о сосредоточенной главной работе. В глубине души я сержусь на всех своих друзей, пока не услышу от них это слово. Мы должны вложить себя в нечто целое, иначе множество делает из нас множество.
Сегодня я пишу так же плохо, как и некоторые друзья — и даже не из мести.
—Что касается меня — дорогой друг, постарайся не ошибиться насчёт меня именно сейчас. Хорошо, у меня есть «вторая природа», но не для того, чтобы уничтожить первую, а чтобы её выносить. От моей «первой природы» я давно бы погиб — я чуть не погиб.
Что ты говоришь об «эксцентричном решении», кстати, совершенно верно. Я мог бы назвать место и день. Но — кто же тогда решился? — Конечно, дорогой друг, это была первая природа: она хотела «жить». —
Прочти мне, пожалуйста, мою работу о Шопенгауэре: там есть несколько страниц, из которых можно взять ключ. Что касается этой работы и идеала в ней — то я до сих пор сдержал своё слово.
Высоконравственные позы я терпеть не могу. Слова в той работе тебе нужно немного перекрасить.
Теперь я стою перед главным. —
Что касается названия «весёлая наука», то я только думал о gaya scienza трубадуров — отсюда и стихи.
От всего сердца
Твой старый друг
Ницше.
Санта-Маргерита Лигуре
до востребования.
Боже! Как я одинок!
346. An Heinrich Köselitz in Annaberg (Postkarte)
Возможно, я неправильно понял ваше последнее указание, дорогой друг; я отправил вам письмо в Аннаберг, а не в Лейпциг. Все еще ничего от Леви? И как обстоят дела с Гевандхаусом? Пожалуйста, передайте от моего имени несколько любезностей проф. Риделю и Фричу — уход был таким быстрым, и многое лежало на сердце. Здесь погода тоже была отчаянной, по крайней мере для моей головы. Я живу в Рапалло, в albergo della Posta: и как единственный. Приезжайте же сюда в Мюнхен! — Письма как и раньше: Santa Marg<herita>, Lig<ure>; ferma in posta.
Сердечно приветствую вас
Ваш Ф. Н.
347. An Lou von Salomé in Berlin (Entwurf)
М<ой> д<орогой> Л<у> берегитесь! Если я теперь отталкиваю вас от себя, то это страшный приговор всему вашему существу! Вы имели дело с одним из самых терпеливых и доброжелательных л<юдей>: но я более, чем кто-либо, способен преодолевать отвращение. Пишите мне другие письма. Одумайтесь, придите в себя!
Я никогда не ошибался в людях: и в них есть то стремление к священному эгоизму, которое есть стремление к повиновению высшему — вы его, я не знаю по какому проклятию, спутали с его противоположностью, эксплуатацией из эксплуататорской радости кошки ради одной только жизни —
Если вы отпустите поводья всему ничтожному в вашей природе: кто тогда сможет иметь с вами дело!
Вы причинили вред, вы причинили боль — и не только мне, но и всем тем л<юдям>, которые любили меня: — этот меч висит над вами
У вас в мне лучший адвокат, но и самый неумолимый судья!
Я хочу, чтобы вы сами себя осудили и сами определили своё наказание.Всё это — вещи, которые нужно иметь, чтобы их преодолеть — чтобы преодолеть себя.
Да, я был на вас сердит: но зачем говорить об этой мелочи? Я сердился на вас каждые 5 дней — и поверьте мне, у меня всегда была на это очень веская причина. Но как я мог бы теперь жить с людьми, если бы не умел преодолевать своё отвращение ко многому человеческому?
Меня оскорбляют не только поступки, но гораздо больше — свойства.
тогда в Орте я решил сначала познакомить вас со всей моей философией.
Ах, вы не представляете, что это было за решение: я думал, что нельзя сделать человеку большего подарка. Очень долгая история (Долгое строительство и возведение)
Тогда я был склонен считать вас видением и воплощением моего идеала на земле. Заметите: я очень плохо вижу.
Я думаю, никто не может думать о вас лучше, но и никто — хуже.
Если бы я создал вас, я бы, конечно, дал вам лучшее здоровье, но прежде всего кое-что другое, что гораздо важнее — и, возможно, немного больше любви ко мне (хотя это как раз меньше всего важно), и всё обстоит так же, как с другом Ре — я не могу ни с вами, ни с ним сказать ни слова о том, что мне всего дороже. Мне кажется, вы совсем не знаете, чего я хочу? — Но это вынужденное молчание порой почти душит, особенно когда любишь М.
348. An Lou von Salomé in Berlin (Entwurf)
Я думаю, никто не может думать о вас лучше, но и никто не может думать хуже.
Всё обстоит так же, как с другом Рée — я не могу ни с вами, ни с ним сказать ни слова о том, что мне ближе всего к сердцу. Это вынужденное молчание порой почти душит меня — особенно потому, что я люблю вас обоих.
Тогда я был склонен считать вас видением, воплощением моего идеала на земле. Заметили? я очень плохо вижу.
Да, я был на вас сердит! Но зачем говорить об этой мелочи? Я сердился на вас каждые 5 дней, а то и чаще — и поверьте мне, у меня были на это очень веские причины. Меня оскорбляют не столько поступки, сколько свойства. Но я беру себя в руки.
И как я мог бы теперь жить с людьми, если бы не сумел преодолеть своё отвращение ко многому человеческому. Я не создавал мир и Лу. — Если бы я создал Лу, то, конечно, дал бы ей лучшее здоровье, но прежде всего кое-что другое, что значит гораздо больше, чем здоровье, — и, возможно, немного больше любви ко мне (хотя это как раз меньше всего значит.)
(В целом я никогда не ошибался в людях.)
Я приписывал вам более высокие чувства, чем другим людям: это, только это, так быстро связало меня с вами. После всего, что мне рассказывали о вас, это доверие было оправдано.
Я причинил бы вам боль и не принес бы никакой пользы, если бы сказал вам, что я называю своей святой эгоистичностью. — Странно! В глубине души я все еще верю, что вы способны на эти высшие и редчайшие чувства: какое-то основное несчастье в вашем воспитании и развитии лишь временно парализовало вашу добрую волю. — Подумайте: тот кошачий эгоизм, который больше не может любить, то чувство жизни в ничто, к которому вы себя причисляете, — это именно то, что мне в человеке отвратительно: хуже всего злого. (Вещи, которые у нас есть, чтобы их преодолеть — чтобы преодолеть себя.): включая познание как удовольствие наряду с другими удовольствиями.И если я вас как-то понимаю: всё это у вас произвольные и навязанные тенденции — насколько это не симптомы вашей болезни (:о чём у меня множество болезненных задних мыслей.)
Тогда в Орте я намеревался шаг за шагом привести вас к последним выводам моей философии — вас как первого человека, которого я считал для этого способным. Ах, вы не представляете, какое это было для меня решение, какое преодоление! Я как учитель всегда много делал для своих учеников: мысль о награде в каком-либо смысле всегда оскорбляла меня. Но то, что я здесь хотел сделать, сейчас, при всё ухудшающемся состоянии моих физических сил, было выше всего прежнего.
Долгое строительство и возведение! Я никогда не думал спрашивать Вас сначала о Вашем желании: Вы едва ли должны были заметить, как Вы втянулись в эту работу. Я доверял тем высшим импульсам, в которые верил у Вас.
— я представлял Вас как своего наследника —
Что касается друга Р<ее>: со мной произошло то же, что и всегда (даже после Генуи): я не могу наблюдать это медленное угасание необыкновенной натуры, не становясь разгневанным. Это отсутствие цели! и, следовательно, это малое удовольствие от средств, от работы, это отсутствие прилежания, даже научной добросовестности. Это постоянное растрачивание! И если бы это было хотя бы растрачивание из удовольствия расточительства! Но оно имеет совершенно вид плохой совести. — Я везде вижу ошибки воспитания. Человек должен быть воспитан как солдат, в каком-то смысле. А женщина — как жена солдата, в каком-то смысле
Spiritus и Portemonnaie.
349. An Paul Rée in Berlin (Entwurf)
Дорогой друг, я называю Л
Это всегда проблема для тысячехудожника самопреодоления (так недавно назвал меня Р
350. An Lou von Salomé in Berlin (Entwurf)
Если моя дорогая Лу была бы средством, чтобы вызвать в вас это чувство и это письмо, то я охотно пострадал бы.
351. An Lou von Salomé in Berlin (Entwurf)
Страдал ли я много, это для меня ничего не значит по сравнению с вопросом: найдёте ли вы себя снова, дорогая Лу, или нет — Я никогда не имел дела с таким бедным человеком, как вы
невежественны — но проницательны
богаты в использовании известного
без вкуса, но наивны в этом недостатке
честны и прямолинейны в деталях, чаще всего из упрямства; в целом, что касается общей жизненной позиции, нечестны (больны от переутомления и т.д.)
Без всякого такта в принятии и отдаче
без сердца и неспособны к любви
в аффекте всегда болезненны и близки к безумию
без благодарности, без стыда перед благодетелем
неверны и предают каждого человека в общении с каждым другим
неспособны к вежливости сердца
не расположены к чистоте и опрятности души
без стыда в мыслях, всегда обнажённые, насильственно по отношению к себе в деталях
ненадёжны
не «хороши»
грубы в вопросах чести
чудовищно отрицательны
«мозг с зачатком души»
характер кошки — хищник, который притворяется домашним животным,
благородное как воспоминание об общении с более благородными людьми
сильная воля, но без великой цели
без прилежания и опрятности
без буржуазной порядочности
жестокизамещённая чувственность
отсталый детский эгоизм вследствие половой недоразвитости и запоздалости
способен к воодушевлению
без любви к людям, но с любовью к Богу
потребность в расширении
хитрая и полная самообладания в отношении чувственности мужчин
352. An Lou von Salomé vermutlich in Berlin (Entwurf)
Сегодня я не делаю вам никаких упреков, кроме того, что вы не были со мной откровенны в нужное время. В Люцерне я дал вам свою работу о Шопенгауэре — я сказал вам, что там изложены мои основные убеждения и что, я верю, они будут и вашими. Тогда вы должны были прочитать и сказать Нет! — В таких вещах я ненавижу всякую поверхностность — мне было бы сэкономлено многое! Такое стихотворение, как «К боли», в ваших устах — глубокая неправда. —
Видите ли, я поступил совсем наоборот: я специально написал письмо госпоже Овербек, чтобы попросить её дать вам некоторые (мной точно указанные) разъяснения о моём характере, чтобы вы не ожидали от меня того, что я не могу вам дать.
У меня самое широкое сердце для различий между людьми.
Однако невыносимо почитать кого-то за качества, противоположные тем, которыми он обладает.
Не говорите ничего любезного, Лу, в свою пользу: я уже сделал для вас больше, чем вы могли — и перед собой, и перед другими.
Люди такого рода, как вы, могут быть терпимыми для других только благодаря высокой цели.
Как убога выглядит ваша человечность рядом с человечностью друга Ре! Как вы бедны в почитании, благодарности, почтительности, вежливости, восхищении — стыде — не говоря уже о более высоких вещах. Что бы вы ответили, если бы я спросил вас: вы порядочны? Вы неспособны на предательство?
У вас нет чувства, что когда человек, как я, находится рядом с вами, ему требуется много преодоления?
Я мог бы сделать это проще с вами: но я уже преодолел себя во многом, так что верю, что смогу и это: быть вам полезным, даже если вы мне вредите.
Знаете ли вы, что я не хочу слышать ваш голос — кроме как когда вы просите?
Вы честны? (Чувство меры в отношении даяния и принятия)
353. An Paul Rée in Berlin (Entwurf)
Я нисколько не сомневался, что она когда-нибудь очистится от грязи этих позорных поступков небесным образом.
Любой другой мужчина отвернулся бы от такой девушки с отвращением: и у меня оно было, но я всегда преодолевал его и, сказать правду: мне жаль видеть благородную натуру в её вырождении.
Этот удар нанесло мне сострадание.
Я потерял то немногое, что ещё имел, своё доброе имя; доверие некоторых людей, я, возможно, потеряю ещё своего друга Рее — я потерял весь год из-за ужасных мук, которым подвергаюсь до сих пор.
Я не нашёл никого в Германии, кто бы мне помог, и теперь я как бы изгнан из Германии, и что больше всего меня ранит — вся моя философия опозорена через — — — перед самим собой мне не нужно стыдиться всего этого дела: самое сильное и сердечное чувство этого года я испытывал к Лу, и в этой любви не было ничего, что относилось бы к эротике. Разве что я мог бы вызвать ревность у милого Бога.
Странно!
Я думал, мне пошлют ангела навстречу, когда я снова обратился к людям и жизни — ангела, который должен был смягчить во мне многое, что стало слишком жестким от боли и одиночества, и прежде всего ангела мужества и надежды для всего того, что всегда передо мной — Но это был не ангел.В остальном я больше не хочу иметь с ней ничего общего. Это было совершенно бесполезное растрачивание любви и сердца. Ну, сказать правду: я достаточно богат для этого.
354. An Paul Rée in Berlin (Entwurf)
Я больше не понимаю вас, дорогой друг (как вы можете это выносить рядом с таким существом! Ради бога, чистый воздух и взаимное высшее уважение! Иначе — — —
355. An Lou von Salomé vermutlich in Berlin (Entwurf)
М<оя> д<орогая> Л<у> не пишите мне таких писем! Что мне до этих жалких мелочей! Замечайте же: я хочу, чтобы вы возвышались передо мной, чтобы мне не пришлось вас презирать.
Но Л<у> какие же вы пишете письма! Так пишут маленькие мстительные школьницы. Что мне до этих ничтожностей! Поймите же: я хочу, чтобы вы возвышались передо мной, а не уменьшались ещё больше.
Как я могу вам простить, если не обнаружу в вас снова сущность, ради которой вам вообще можно простить!
Нет, м<оя> д<орогая> Л<у> мы ещё далеко не дошли до «прощения».
Я не могу просто так простить, после того как обида успела за 4 месяца в меня вползти.Прощайте, моя дорогая Лу, я не увижу вас снова. Берегите свою душу от подобных поступков и воздайте другим, и особенно моему другу Рée, то, что вы не можете воздать мне.
Я не создал мир и Лу: я хотел бы, чтобы я это сделал — тогда я мог бы один нести всю вину за то, что между нами произошло так.
Прощайте, дорогая Лу, я не дочитал ваше письмо до конца, но я уже прочитал слишком много.
356. An Unbekannt (Entwurf)
Только с того момента, когда я откажусь от Лу, вы можете презирать её — тогда она станет презренным существом — сказал я своим знакомым.
Мне жаль Лу: она отказалась от всякой высшей цели и всякого идеала — это ужасно и удручающе
357. An Malwida von Meysenbug in Rom (Entwurf)
Как это произошло? — Но когда я прочитал ваше письмо, я разрыдался. — Однако сегодня я не хочу говорить о себе.
Вы хотели знать, что я думаю о фр. Саломе.
М<оя> сестра считает Л<у> ядовитым насекомым, которого нужно уничтожить любой ценой, и действует соответственно. Это мне кажется совершенно преувеличенной точкой зрения и мне совершенно противно: наоборот, я бы от всего сердца хотел быть ей полезным и способствовать её лучшему во всем смысле. Могу ли я это сделать, смог ли я это сделать до сих пор — это вопрос, на который я не хочу отвечать: я честно старался.
Для моих интересов она до сих пор была мало доступна; и я сам для неё (как мне кажется) скорее что-то лишнее, чем интересное: знак хорошего вкуса!
В ней многое иное, чем у Вас — и даже у меня: она выражается наивно и в этой наивности полна очарования для наблюдателя за людьми. Её ум чрезвычайен, и Рее считает, что Лу и я — самые умные существа — откуда Вы видите, что Р<ее> — льстец.
Но я прошу Вас от всего сердца сохранить Ваше чувство нежной привязанности, которое Вы испытывали к фрл. С<аломе>, — и даже усилить его.
Но в чём заключается это больше, — об этом я не могу писать.Семья Р<ée> заботится о молодой девушке самым приятным образом, и Поль снова является образцом деликатности и заботы.
Моё здоровье пока не позволяет мне ехать на север, да я и устал от Европы, мне нужен вечно голубое небо, чтобы выносить жизнь.
„Тысячехудожник самопреодоления“ — так недавно назвал меня Роде. В моём „я“ есть ужасно многое, что нужно преодолеть.
Слово из одного из моих сочинений, которое вы цитируете, — я его уже не помню —
Моя дорогая уважаемая подруга, вы, конечно, ожидали услышать от меня что-то другое. И когда я вас увижу, я буду говорить иначе. Но писать? Нет.
358. An Malwida von Meysenbug in Rom (Fragment)
Моя дорогая уважаемая подруга,
Как же это произошло? Но когда я прочитал Ваше письмо, я разрыдался. — Однако сегодня я не хочу говорить о себе.
Вы хотели знать, что я думаю о фрейлен Саломе? — Моя сестра считает Лу зловредным насекомым, которого нужно уничтожить любой ценой — и действует соответственно. Это, на мой взгляд, совершенно преувеличенная точка зрения и совершенно чужда моему сердцу. Напротив: я хотел бы быть ей полезным и способствующим, в самом высоком и самом скромном смысле этого слова. Могу ли я это сделать, смог ли я это сделать до сих пор — это, конечно, вопрос, на который я не хотел бы отвечать: я честно старался.
Для моих „интересов“ она до сих пор была мало доступна; я сам для неё (как мне кажется) скорее что-то лишнее, чем интересное: знак хорошего вкуса! В ней многое иное, чем у Вас — и даже у меня; она выражается наивно и в этой наивности для наблюдателя за людьми полна очарования. Её ум чрезвычайен: Рée считает, что Лу и я — самые умные существа — откуда Вы видите, что Рée — льстец.
Семья Рée заботится о молодой девушке самым приятным образом; и Поль Р<ée> здесь снова образец деликатности и заботы.
Моя дорогая уважаемая подруга, возможно, Вы хотели услышать от меня что-то другое о Л<у>; и когда я снова увижусь с Вами, Вы услышите от меня и другое. Но писать? Нет. —
Но я прошу Вас от всего сердца, сохранить чувство нежной привязанности, которое Вы испытывали к Л<у>, — да, сделать больше! Но в чём состоит это „больше“, об этом я <не могу писать.>
[ + + + ] Одинокие люди страшно страдают от воспоминаний.
Не беспокойтесь — в глубине души я солдат и даже своего рода „тысячерукий мастер самопреодоления“.(Так недавно назвал меня друг Роде, к моему удивлению)
Дорогая подруга, разве нет на свете ни одного человека, который любил бы меня? — —
[+ + +]
359. An Franz Overbeck in Basel
Дорогой друг, сердечная благодарность за твои вести! Дела идут немного лучше, или, вернее, станут лучше! Много приступов позади меня. Это почти смешно: вот уже 3 года подряд почти в одно и то же время я верил в свой «конец всех вещей»! Тем не менее: я живуч, и в другом отношении у меня еще достаточно жесткости к себе, чтобы посмотреть жизни в лицо, даже если она меня издевается.
Впрочем, в следующем году я должен что-то изобрести в отношении своего будущего и обеспечить себе немного больше безопасности. Со всей своей «разумностью» я остаюсь страстным и внезапным существом; одиночество становится все более опасным.
—В этом году я вернулся к «людям» с настоящим желанием — я думал, что мне уже можно оказать немного любви и уважения. Я столкнулся с презрением, подозрениями и, в отношении того, что я могу и хочу, с ироничным безразличием. Из-за некоторых злых случайностей я пережил всё это в самой жестокой форме. — Объективно говоря: это было крайне интересно. —
Теперь я стою совсем один перед своей задачей и знаю также, что меня после её решения ожидает. Мне нужно оплот против невыносимого. — —
Представь себе: у меня появился новый последователь — а именно, Ганс фон Бюлов («преданное участие ко мне»). Также меня удивило письмо доктора Г. фон Штейна — он совсем онемел от «весёлой науки» и посылает мне «почтительный привет».
Мне пришло в голову, что я бы очень хотел ещё раз услышать твою дорогую жену о Санктусе Януарии.
Бизе был большим наслаждением, я хотел бы вокруг себя немного бизетизма в самых разных формах. Мне необходима идиллия — для здоровья.
С самым сердечным приветом
(Санта-Маргарита Лигуре, до востребования.)
Твой друг Ф. Н.
360. An Paul Rée und Lou von Salomé in Berlin (Entwurf)
Я здесь, чтобы говорить как вольнодумец в школе аффектов, то есть аффекты пожирают меня. Ужасное сострадание, ужасное разочарование, ужасное чувство уязвлённого гордости — как я ещё выдержу? Разве сострадание не чувство из ада? Что мне делать? Каждое утро я отчаиваюсь, как пережить день. Я больше не сплю: что толку 8 часов маршировать! Откуда у меня эти сильные аффекты! Ах, немного льда! Но где есть для меня ещё лёд! Сегодня вечером я приму столько опиума, что потеряю рассудок: Где ещё есть человек, которого можно почитать!
Но я знаю вас всех насквозь.Не слишком беспокойтесь о вспышках моего величия или моего уязвлённого тщеславия: и если я даже случайно из-за этих аффектов лишу себя жизни, то и тогда не будет особо чего оплакивать. Какое вам дело до моих фантазий — я имею в виду вас и Лу! Подумайте оба хорошенько, что я в конце концов — страдающий головными болями полусумасшедший, которого одиночество окончательно сбило с толку. — К этому, как я считаю, разумному пониманию положения дел я пришёл после того, как принял огромную дозу опиума от отчаяния. Вместо того чтобы потерять рассудок, он, кажется, наконец-то ко мне приходит.Кстати, я действительно был болен несколько недель: и если я скажу, что здесь у меня было 20 дней погоды Орта, вам станет понятнее моё состояние. Попросите Лу всё простить мне — она тоже даёт мне возможность простить её. Потому что до сих пор я ей ничего не простил. Своим друзьям прощаешь гораздо труднее, чем врагам.
Тут мне приходит на ум защита Лу. Странно! Как часто кто-то оправдывается передо мной, так всегда получается, что я должен быть неправ. Это я уже знаю заранее, и поэтому это меня больше не интересует.
Может быть, Лу — неузнанный ангел? Может быть, я — неузнанный осёл?
in opio veritas: Да здравствует вино и любовь!
Не мучайтесь угрызениями совести! Я же так привык: в этом году все будут на меня злиться, в следующем, возможно, все будут радоваться мне.
361. An Lou von Salomé und Paul Rée in Berlin (Fragment)
Мои дорогие, Лу и Ре!
Не тревожьтесь слишком сильно из-за вспышек моего «мегаломании» или моего «уязвлённого тщеславия» — и если я сам, по какому-то аффекту, случайно когда-нибудь решу покончить с собой, то и здесь не будет особо чего оплакивать. Какое вам дело до моих фантазий! (Даже мои «истины» до сих пор вас не касались) Подумайте оба хорошенько, что я в конце концов — страдающий головными болями полусумасшедший, которого долгая одиночество окончательно сбила с толку.
К этому, как я считаю, разумному пониманию положения дел я пришёл после того, как принял огромную дозу опиума — от отчаяния. Вместо того чтобы потерять рассудок, он, кажется, наконец-то ко мне пришёл. Впрочем, я действительно болел несколько недель; и если я говорю, что здесь у меня было 20 дней орта-ветра, то мне нечего больше добавлять.
Друг Ре, попросите Лу простить мне всё — она тоже даёт мне возможность простить её. Потому что до сих пор я ей ещё ничего не простил.
Своим друзьям прощают гораздо труднее, чем врагам.
Тут мне приходит на ум «защита» Лу [ + + + ]
362. An Paul Rée in Stibbe (Entwurf)
Я пишу это в ясную погоду: не путайте мой разум с безумием моего недавнего опиумного письма. Я вовсе не сумасшедший и не страдаю манией величия. Но у меня должны быть друзья, которые вовремя предупредили бы меня о таких отчаянных вещах, как те, что случились этим летом.
Кто мог предположить, что их слова о героизме «бороться за принцип», их стихотворение «к боли», их рассказы о борьбе за познание — просто обман? (Их мать написала мне этим летом: Л
Или дело обстоит иначе? Лу в Орте была другим существом, нежели та, которую я нашел позже. Существом без идеалов, без целей, без обязанностей, без стыда.
И на самой низкой ступени человечества, несмотря на её хороший ум!
Она сама мне сказала, что у неё нет морали — и я подумал, что у неё, как и у меня, более строгая, чем у кого бы то ни было! и что она ежедневно и ежечасно приносит что-то в жертву.
Пока же я вижу только, что она стремится к развлечению и удовольствию: и когда я думаю, что к этому относятся и вопросы морали, меня, мягко говоря, охватывает негодование. Она очень обиделась на меня за то, что я отрицал её право на слова «героизм познания» — но она должна быть честной и сказать: «я бесконечно далека от этого». В героизме речь идёт о самопожертвовании и долге, причём ежедневном и ежечасном, и, следовательно, о гораздо большем: вся душа должна быть наполнена одним делом, а жизнь и счастье должны быть безразличны по сравнению с ним. Такую натуру я думал увидеть в Лу.
Послушайте, друг, как я сегодня смотрю на это дело! Она — совершенное несчастье — и я его жертва.
Весной я думал, что нашёл человека, который способен помочь мне: для чего, конечно, нужны не только хороший интеллект, но и моральность высшего ранга.
Вместо этого мы обнаружили существо, которое хочет развлекаться и достаточно бесстыдно, чтобы верить, что для этого лучшие умы Земли как раз достаточно хороши.Результат этого недоразумения для меня в том, что я больше, чем когда-либо, лишён средств, чтобы найти такого человека, и что моя душа, которая была свободна, мучается множеством отвратительных воспоминаний. Ведь всё достоинство моей жизненной задачи было поставлено под сомнение поверхностным, аморальным, легкомысленным и бездушным созданием, как Лу, и даже моё имя
моя репутация запятнана
Я думал, вы убедили её помочь мне.
Паулю Рée
363. An Franziska und Elisabeth Nietzsche in Naumburg (Entwurf)
Ты должен подумать о другом тоне, чтобы говорить со мной: иначе я больше не буду принимать письма из Наумбурга!
Я просто не могу заставить себя открыть письмо из Наумбурга; и я все меньше понимаю, как вы собираетесь исправить то, что сделали со мной этим летом, последствия чего продолжают преследовать меня.
364. An Franz Overbeck in Basel (Entwurf)
Дорогой друг, этот кусок жизни был самым жестким, который я когда-либо жевал; все еще возможно, что я задохнусь от него. Я страдал от унизительных и мучительных переживаний этого лета, как от безумия. Все это время я, возможно, спал всего 4, 5 ночей — и даже это только с самыми сильными дозами снотворного. Все мое мышление, творчество и стремления охвачены разрушениями этих аффектов. Что из этого выйдет! Я напрягаю каждую волоконцу самопреодоления — но — это слишком для человека такой долгой одиночества
Сегодня в пути мне пришла в голову мысль, которая очень меня рассмешила: она обращалась со мной как со студентом 20 лет — очень допустимый образ мышления для девушки 20 лет — со студентом, который влюбился в нее. Но мудрые, как я, любят только призраков — и горе, если я полюбил бы человека — я скоро погиб бы от этой любви. Человек — слишком несовершенное существо
365. An Franz Overbeck in Basel
Дорогой друг
возможно, ты вообще не получил моё последнее письмо? — Этот последний кусок жизни был самым жёстким, который я когда-либо жевал, и всё ещё возможно, что я им задохнусь. Я страдал от оскорбительных и мучительных воспоминаний этого лета, как от безумия — мои намёки в Базеле и в моём последнем письме всегда умалчивали о самом главном. В этом противоречие противоположных аффектов, с которым я не могу справиться. Это значит: я напрягаю все волокна своего самопреодоления — но я слишком долго жил в одиночестве и питался своим «собственным жиром», так что теперь меня сильнее, чем других, разрывает колесо собственных аффектов. Если бы я только мог заснуть!— но даже самые сильные дозы моих снотворных помогают мне не больше, чем мои 6—8 часов маршировки.
Если я не изобрету алхимический трюк, чтобы сделать из этого — дерьма золото, то я погиб. — У меня есть самый прекрасный случай доказать, что для меня „все переживания полезны, все дни священны и все люди божественны“!!!!
Все люди божественны. —
Моё недоверие сейчас очень велико: я чувствую презрение к себе во всём, что слышу. — Например, недавно из письма Роде. Я всё же готов поклясться, что он, без случайной прежней дружбы,
Теперь в самом подлом виде судить обо мне и моих целях.
Вчера я также прервал переписку с матерью: это стало невыносимо, и было бы лучше, если бы я давно уже не выдерживал этого. Насколько далеко распространились враждебные суждения моих родственников и портят мою репутацию — — ну, я бы все равно предпочел знать это, чем страдать от этой неопределенности. —
Мои отношения с Лу находятся в последних, самых болезненных стадиях: так я думаю сегодня, по крайней мере. Позже, — если будет потом, — я скажу об этом слово. Сострадание, мой дорогой друг, — это своего рода ад — что бы ни говорили последователи Шопенгауэра.
Я не спрашиваю тебя: „что мне делать?“ Несколько раз я думал о том, чтобы снять комнату в Базеле, навещать вас время от времени и слушать лекции. Несколько раз я думал и о противоположном: довести свое одиночество и отречение до последней точки и —
Ну, пусть это идет своим путем! Дорогой друг, ты с твоей достойной уважения и умной женой — вы для меня почти последний клочок надежной земли. Странно!
Пусть вам будет хорошо!
Твой Ф. Н.
366. An Franz Overbeck in Basel
Дорогой друг
Сердечная благодарность за твои два письма. И сегодня ты не удивишься, услышав, что я пока ещё не стал мудрым. Огромное напряжение, с которым я преодолевал боль и отречение последние 10 лет, мстит мне в таких состояниях; я слишком стал машиной, и опасность не мала, что при таких резких движениях пружина сломается.
Я был в Генуе три раза, но не нашёл комнаты, которая мне нужна сейчас, а именно с печкой. Холодно, я уже привык к огню в Лейпциге — и, наконец, у меня не так много тепла в запасе. В Генуе нет печек.
Самый холодный месяц только что у двери.В конце концов, ничего не помогает, я должен остаться здесь. Для моей головы близость моря — облегчение, и это не стоит недооценивать, так как я, как понятно, снова очень много страдаю и физически.
Я ведь не дух и не тело, а нечто третье. Я всегда страдаю всем и во всём. —
Ну, что будет? Моё самопреодоление — в сущности, моя сильнейшая сила: я недавно размышлял о своей жизни и понял, что до сих пор ничего не сделал. Даже мои «достижения» (и особенно с 1876 года) относятся к аспекту аскезы. Аскеза, конечно, выглядит у этого человека иначе, чем у другого. (Даже «Санктус Януариус» — книга аскета — моя дорогая госпожа профессор Овербек!)
С сердечным приветом
Твой Ф.Н.
И слава новому году — чтобы не говорить о старом!
Сильвестр 1882 (мне становится жутко от этой даты.)